Michael Wohlfahrt neu
März 25, 2023 um 18:09 | Veröffentlicht in St.Veit | Hinterlasse einen KommentarEs heirat sich, es heirat sich, es heirat sich so schön!
Nur muß man es versteh´n,
Mit Weibern umzugeh´n!
(nach Dr.Adalbert Schmidt 1903-1994)
Oh ja, mit den Frauen versteht er es wirklich, der jugendliche Michel! Ein tiefer Blick aus seinen blauen Augen da, ein galantes Kompliment dort und die holde Weiblichkeit schmilzt dahin. Das Schönreden beherrscht er wie kein anderer und die Tanzkunst hat er sich früh schon und ganz ohne fremde Hilfe angeeignet. Ein paarmal den Spielleuten aufmerksam zugehört und dabei den Tanzenden genau auf die Füße geschaut, das hat genügt. Wieder bei der Arbeit und beim Stallauskehren, wenn grad sonst niemand in der Nähe war, wird mit Musik und Takt im Kopf gleich geübt – mit dem pirkenen Besen als Partnerin! Später, als er dann in Vorbereitung des Lebmacher Kirchtags eigenhändig den Tanzboden zimmert, gibt es keine Hemmungen mehr, auch echte Partnerinen auszuführen. Sein Lieblingstanz ist der Tramplan. Er beherrscht aber auch die Masur(ka) – Polka und Walzer sowieso. Die „Lustigen Zwanziger Jahre“ bieten reichlich Tanzgelegenheit, auch weit über die traditionellen Kirchtagszeiten hinaus.
Eines schönen Morgens im Oktober ist die Schotterstraße nach St.Veit so stark begangen und befahren, daß die endlose Schlange von Menschen und Fuhrwerken fast nicht abreißt. Von Friedlach und Kadöll, von Maria-Feicht und Glanegg, aus der Gegend von Zweikirchen und Rohnsdorf aber auch von den Bergorten Liemberg, Gradenegg, Glantschach und Pulst drängen die Pferdewagen heran, alle gut besetzt und nicht selten mit einem Fohlen oder Rind am Wagenende festgebunden. Alles hat zum gemeinsamen Ziel, den Wiesenmarkt in der alten Herzogstadt. Bauersleute, Knechte und Mägde sind fesch herausgeputzt, gut gelaunt und erwartungsfroh. Die Herrenbauern hingegen haben noch etwas Zeit. Sie müssen sich nicht selbst um Unterbringung der Zugtiere und um Aufstellung der zu verhandelnden Tiere kümmern. Es genügt, wenn sie sich mit Kales (Kalesche), oder gar Landauer, mit dem Steirer-auch Stadtwagerl genannt, zu späterer Tageszeit auf den Weg machen. Sie werden beim „Bruckenwirt“ oder beim „Grünen Baum“ einstellen. Die dortigen Hausknechte werden sich für ein gutes Trinkgeld der Pferde annehmen, auch wenn es bis spät in die Nacht dauern sollte. Feierlich und selbstbewußt wird man dann den kurzen Weg auf die Wiese zurücklegen, da- und dorthin grüßen oder sich grüßen lassen. Zuerst geht es einmal zum gewaltigen Viehauftrieb. Wer hat wohl diesmal die schönsten Ochsen und die feurigsten Rösser? Sind die richtigen Käufer eingetroffen? Wie verhält sich Angebot und Nachfrage? Ist dieser Teil des Marktes endlich gut vorüber, dann muß man noch bedenken, daß zu Micheli die Leihkäufe, sprich die Dienstverträge für das nächste Jahr fällig sind. Bleibt der Hausknecht, der Roßknecht, die Feld- Sau- oder Kucheldirn übers Jahr, oder werden sie sich verändern? Nehmen sie den Leihkauf, oder haben sie diesen vielleicht schon von anderer Seite angenommen? Ja, der Bauer muß an vieles denken, ehe er seine Leute auf den Rummelplatz mit Schaukeln, Schießbuden, Ringelspielen, Panoptikum, Geisterbahn usw führen kann. Spätestens jetzt ist auch das sogenannte Marktgeld – ein Zehrgroschen für das Gesinde und die Kinder – zu reichen. Das kann verschieden hoch ausfallen, nicht immer nach der Wohlhabenheit, sicher aber je nach Geiz oder Freigebigkeit des Spenders! Mit diesem kleinen Besitz in Händen, beginnt nun ein hartes Kämpfen und Abwägen auf seiten der Dienstboten. Soll ich bei den Lebzeltern vorbeischauen oder zu den Standlern gehen, die fürs ganze Jahr Notwendiges feilbieten? Soll der Knecht auf den Tanzboden oder auf die Kegelbahn? Harte Fragen fürwahr. Dazu ist die Zeit nicht endlos, denn am Abend wartet daheim wieder die tägliche Stallverrichtung. Diese blöden Rindviecher kennen ja keinen Sonntag und keinen Markttag! Was für ein Glück, das Geld hat gar noch für ein wenig Türkischen Honig und ein Stanizel Kokosbusserln gereicht, denn an die Haushüter zu denken und ihnen einen „Markt“ heimzubringen, das gehört sich einfach.
Auch unser Michel ist an diesem Tag zeitig auf den Beinen. Er hat sich fesch gemacht und
will schon aus dem Dorf hinaus auf St.Veit zu streben, da kommt wie zufällig die Familie des Maurermeisters Valent, Francesco mit Namen, den Mulle-Weg herunter um ebenfalls die Richtung zur Stadt hin einzuschlagen. Michel lupft artig grüßend den Hut, fragt, ob er sich
der Gesellschaft anschließen darf. Das wird ohne besonderes Aufsehen akzeptiert.
Die Söhne des Maurers kennt Michel längst schon recht gut und auch ein wenig die Töchter.
Nur heute ist da ein neues Gesicht darunter und was für eines! Frieda, von der er bisher nur den Namen nennen gehört hat, ist aus der Oststeiermark, wo sie seit der Internierung der Friulaner im Jahre 1915 Bauernarbeit und steirische Armut in einem kennenlernen durfte, als letzte endlich wieder zurück. So kurzweilig sind die fünf Kilometer Fußmarsch dem Michel noch nie vorgekommen. Erst einmal beim Mansfelder Riegel und beim Schwarzfurterkreuz angelangt, ist der Wiesenlärm und das Musikgedudel schon ganz deutlich zu hören, was die fröhliche Wanderschar noch mehr beflügelt. Michel nimmt sich vor, seine neue Bekannte nicht mehr aus den Augen zu lassen. Er zeigt sich von seiner besten Seite, gibt sich locker und splendid. Gemeinsam genießt man das Bad in der Menge, die kleinen Vergnügungen und insbesondere das Geschenk an alle Verliebten, welches nur der Wiesenmarkt so richtig verschafft: Man kann leicht jeden verlieren, der vielleicht störend wäre und sich doch dabei fürs Leben finden…..
Die dreifärbige Katz
Die Schlintlin hat Besuch. Mitzl, fragt sie, weißt Du mir keine junge Katz? Unser alter Petzel (Kater) ist wirklich für nichts mehr zu brauchen. Dem laufen die Mäuse unter seinen Ratzen vorbei, doch er rührt sich nicht von der Ofenbank.
Oh, meint die Mitzl, vielleicht kann ich Dir sogar zu einer dreifärbigen Katz verhelfen, das
sind ja doch die aller aller besten zum Mausen. Ob Feldmaus oder Hausmaus, eine Dreifärbige ist fleißig und erwischt sie alle.
Jetzt mit Mitte der Zwanziger Jahre sind gar viele Dreifärbige unterwegs, allerdings auf Menschenbeinen. Ob in Häusern oder auf Plätzen, sie sind nur darauf aus, anstatt Mäuse
Menschen zu fangen. Wir haben ja neuerdings eine demokratische Republik und die Macht geht vom Volke aus, so steht es in der Verfassung, also werden Anhänger gebraucht. Dabei hat den neuen Staat eigentlich keiner so richtig gern. Wie lang wird er seine Gründung überleben ?
Natürlich, ein Acht-Stunden-Tag, ein bezahlter Urlaub, gerechter Lohn das alles würde wohl auch unserem Michel taugen. Aber wer verhilft ihm zu seinem Recht? Gut, die paar Eisenbahner, die er kennt, die haben das wirklich schon und vielleicht sogar noch ein bißchen mehr. Es ist auch schon einer von ihnen im Gemeinderat, aber zu reden hat er dort nicht viel. Da redet der Herr Oberförster im Namen des Grafen und da reden drei Besitzer, einer aus Feistritz, die zwei andern aus Pulst und Lebmach. Die sagen, die Sozi wollen zuviel auf einmal, das können wir uns nicht leisten. Außerdem verfolgen die Sozialisten die Weltrevolution. Man sieht das ja in Rußland und hat es gesehen in Ungarn, Berlin und München. Wer kann denn für die Internationale oder für die Internationalen sein, die unseren guten alten Staat in Grund und Boden gehauen haben? Nicht genug, daß sie unser Territorium empfindlich kleiner gemacht haben, jetzt verbieten sie uns auch noch die einzige Überlebensmöglichkeit, das Zusammengehen mit Deutschland. Nein und nochmals nein, den Sozis kann man nicht trauen, selbst wenn die Sozialisten Bauer und Renner für den Anschluß mit Deutschland sind, einem sozialistischen Deutschland, versteht sich. So reden sie, die Menschenfänger.
Otto Gutzinger, Bahnarbeiter in Pulst, ein Sozialist der ersten Stunde will die revolutionären Ereignisse rund um Österreich nicht bestreiten, er hält seinen politischen Kontrahenten aber einen Spiegel vor, wie menschenunwürdig die Landarbeiter wohnen, nämlich hauptsächlich in
Viehställen, wie lange sie bei schlechter Kost und bei geringer Bezahlung zu arbeiten haben, wie die Handwerker ihre Bediensteten ausbeuten usw. Bürger und Bauern im Verein mit der
Katholischen Kirche wollen als Lakaien der Habsburger ja nur alle neuen Errungenschaften der Arbeiterschaft wieder beseitigen und die Republik stürzen. Das aber werde die Mehrheit zu verhindern wissen.
Ja, ein Eisenbahner hat leicht reden, der hat seinen sicheren Posten, der wird vom Staat bezahlt, ob er was tut oder nicht. Aber wenn wir einmal nichts mehr verdienen, wird auch der Staat uns nichts mehr nehmen können, oder wird man uns dann vielleicht auch noch um Grund und Boden bringen? Nein, nein und was die Habsburger angeht, der alte Kaiser war nicht der schlechteste. So wogt der Streit hin und her, Michel merkt es wohl, aber wer hat da recht, wer sagt die Wahrheit?
Doch da gibt es eine weitere politische Richtung. Deren Vertreter sagen, ja, schon sozial, auch sozialistisch aber deutsch und sie gründen die Österreichische Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, diese ist 1918 aus der Deutschen Arbeiterpartei Österreichs hervorgegangen. Ihr Führer ist jetzt Dr.Walther Riehl. Wer also nicht sozialistisch, nicht christlich-sozial oder monarchistisch fixiert ist, liebäugelt schon ein bißchen mit solchen Ideen. Bemerkenswert an dieser Bewegung ist, daß sie als einzige Partei ohne historische Vorbelastung und ohne jegliche Rücksichtnahme auf Regierungsverantwortung eine ausgeprägt revanchistische, für die damaligen außenpolitischen Verhältnisse gerade in Kärnten nicht unpopuläre Politik machen kann. Neu ist auch die moderne Art der werbenden Ansprache bei weitgehenster Überwindung des gesellschaftlichen Gefälles. Gerade letzteres ist geeignet manch kleinem Mann durchaus zu schmeicheln und ihn zum überzeugten Anhänger zu machen. Nach und nach wird das Schlagwort von der sogenannten Volksgemeinschaft ins Spiel gebracht und vereinzelt auch tatsächlich gelebt. Die anderen Mitbewerber können aus ihrer alten Haut nicht so einfach heraus, sind dadurch weniger glaubwürdig und selten erfolgreich in der tagespolitischen Auseinandersetzung.
Michel gib acht, überall schleichen sie herum die zweifüßigen, die mehrfärbigen Katzen, sie lauern auch Dir schon auf! Wehe Dir, falls Du den Ehrgeiz haben solltest, Dich auf die vermeintlich richtige Seite stellen zu sollen!
Das Dorf der Namenlosen
Aber natürlich, jeder im Dorf hatte seinen eigenen Namen. Was aber fehlte und ihm täglichen Verkehr untereinander fast keine Rolle spielte, war der Familienname. Die Kombination
des Taufnamens mit Zugehörigkeit, Stellung oder Eigenart war stets nicht nur ausreichend, sondern meist treffender. Ob in der Anrede, weniger in der Rede von der dritten Person, man kam fast stets ohne Familiennamen aus. In vielen Fällen blieb dieser ein Leben lang ungenannt und so auch unbekannt. Vielleicht erst am Grabhügel schien der volle richtige
Name letztendlich auf. Solches trifft in erster Linie für die vielen Dienstboten des örtlichen Gutsbesitzers, der seinerseits nur „Herr Chef“ genannt wurde oder auf Hauleute anderer Bauern zu. Einige Beispiele dieser ersten Spezies wären:
Die Xandl – eine unsagbar fleißige Felddirn. Wie oft versagte sie sich den mittäglichen Heimweg von den fernen Glangründen herauf ins Dorf, um nur ja keine Zeit unnütz zu vertun.. Fragte man sie, ob sie denn nicht hungrig sei, bekam man zur Antwort, hab wohl Brotale da……Endlos und zahlreich waren die Türken- oder Krautackerzeilen, die es durchzuharken
galt, ob Sonne oder Regen. Der alte Chef soll schon sehr gut das beherrscht haben, was moderne Personalberater heute Mitarbeitermotivation nennen. Er ging den Dirnen nach, lobte die schnellste an der Spitze mit den Worten, Du Xandl bist wohl meine Beste, da nimm ein Zuckerl. Obwohl der die Zurückliegenden ermahnte, der alten Xandl doch mehr nachzueifern, kamen sie an diese trotz bestem Willen nicht mehr heran. So einfach steigerte man schon damals die tägliche Arbeitsleistung!
Die Sefa – könnte eine Verwandte der Xandl gewesen sein, sie war aber schon ziemlich in den
Jahren und ihre Tochter war
Die Taubstumme Susa. Diese beherrschte die Gebärdensprache, konnte aber recht wild werden wenn sie das Gefühl hatte, von schlimmen Kindern durch sinnloses und ungehöriges Gestikulieren mit Händen und Fingern oder gar durch Grimassenschneiden gefoppt zu werden. Auch die Susa ihrerseits hatte einen Sohn, er wurde kurzerhand
Der Susebua – also der Sohn der Susa geheißen und wurde diesen Namen noch lange über
den Schulbeginn hinaus nicht los. Erst allmählich tauchte sein Taufnamen Franz im
allgemeinen Gebrauch auf. Er ist ein äußerst tüchtiger Arbeiter, ja zur rechten Hand
des Chefs geworden und lebt heute als ein allgemein geachteter und angesehener Mensch.
Die Olga – Daß sie mit zweitem Namen Bölderl hieß, hat eigentlich niemanden interessiert.
Sie war Kindermädel und eine herzensgute Frau. Natürlich galt die erste Zuwendung ihren
Schutzbefohlenen, aber sie hat auch darüber hinaus viel Gutes getan. Artige Spielkameraden und Schulfreunde ihrer „Kinder“ konnten sich über ihre zahlreichen Gunsterweise nicht
beklagen. Sie setzte zum Wohle ihrer Lieben manches im Hause durch, was man sonst nicht gerne zugelassen hätte, gute Mahlzeiten, Theaterspiele, Gartenfest usw. Ihr Grabstein steht noch am Lebmacher Friedhof.
Die Zila – eigentlich Cäcilia Rieser, unverheiratet und kinderlos, kannte ein Leben
lang nichts wie harte Arbeit im Haus und auf dem Feld.
Noch um vieles anonymer waren die Roß- und Stallknechte und die zahlreichen Feld- ,
Stall- , Sau- oder Kucheldirnen. Sie lebten nur mit ihrem Vornamen, ab und zu, weil es
mehrere von ihrer Art gegeben hat, dieser erweitert um Zusätze wie alte(r) – junge(r), große(r) – kleine(r) und dgl. Eine nette Abart vor dem Taufnamen war der sächliche Artikel und dieser
konnte verschiedenes bedeuten, etwa die kleine Statur wie bei
Das Wriesnegger-Sofale – Sofie Lippnig wurde in ihrem Pensionsalter wohl die weitestgereiste ehemalige Dienstmagd weit und breit. Sie machte viele Fahrten und Flüge bis ins Heilige Land und darüber hinaus. Sie ist immer noch geistig frisch und munter, eine Stütze des Hauses am Sonnenhang in St.Veit und eine gar fleißige Kirchgängerin.
Das Alberer Irgele – war zwar auch kein Riese, aber der Artikel davor könnte hier ausdrücken, daß er ein gutmütiges Hascherl war, das übrigens auch selten bei einer kirchlichen Prozession gefehlt hat. Trotzdem war es eine Besonderheit von ihm, Kindern beiderlei Geschlechtes bereitwilligst seine Männlichkeit zu zeigen.
Bei den Handwerksmeistern des kleinen Ortes ist zweierlei zu beobachten. Wenn sie eine
Firmentafel mit Namen am Hause aufzuweisen hatten, dann wurde ihnen auch der Familienname selten streitig gemacht. Aber der Wagnermeister Sereinig, gleich neben dem Lebmacher Friedhofstor, leistete sich keine Tafel und war deshalb
Der Lebmacher Wagner – in direkter Anrede der Herr Wagner, obwohl er Sereinig hieß.
Sein Sohn Alexander, arbeitete in der Wagnerei mit und war so
Der Wagner Xander – von ihm ist sein Stehsatz überliefert, der lautete, Ich sag ja nichts,
ich mein ja nur! Seine Schwester war
Das Wagner Mitzale – hier sächlich, vielleicht für Mädchen oder auch weil sie wirklich ein
niedliches Ding war, das früh hat sterben müssen.
Nun ein paar Abarten, die sich schwer in ein eigenes Schema bringen lassen und wo der Kurzname bzw. die Namenskombination anderen Ursprungs ist.
Die Hans Tant oder die Schwarze Wutte, hatte zwei Namen, je nachdem ob ihre Anverwandten oder Außenstehende mit oder von ihr gesprochen haben. Sie war einfach die
Witwe des Onkel Hans und hatte tiefschwarze Haartracht. Gewohnt hat sie im alten Egger-Haus mit dem Ausgang über den Egger Garten. So wurde sie zur gewissen Jahreszeit ganz zwangläufig zur gefürchteten Wächterin der Marillenbäume und deren wohlschmeckender Früchte. Hier her gehört allenfalls noch
Die Gaggl Tant – Sie wird sich als Schwägerin des Gastwirtes Gaggl möglicherweise Raab geschrieben haben, aber sicher ist das nicht.
Im Nebengebäude der Restauration Lebmach, heute Glantaler Hof genannt, bewohnte
Der Viktor – mit Frau und Kindern einen einzigen Raum. Der Familienname sei ungenannt.
Sie kamen von Pisweg. Als ehemaliger Landarbeiter mußte Viktor erst langsam gewisse
handwerkliche Fertigkeiten anlernen. Seine Frau, die Sefa, war nicht gerade, was man
eine Venus von Milo nennen hätte müssen, aber sie war eine Harschtige. Obendrein schielte sich recht ordentlich, sodaß gesagt wurde, sie schaue mit ihrem rechten Auge in die linke Schürzentasche und umgekehrt. Trotzdem, als die Sefa dem Viktor gerade wieder einmal die Hölle so richtig heiß gemacht gehabt hatte, entfuhr Viktors gequälter Brust der bemerkenswerte Ausspruch, Du Michel, wenn ich wieder einmal heirat, auf die Schönheit schau ich nie mehr!
Die Hausherrin des Viktor schrieb sich übrigens Juliane Egger, aber für die Lebmacher war sie
Die Wirt Jula
Nicht vergessen werden soll auf zwei Beispiele, die ihre Profession im Namen getragen haben::
Der Gärtner Poltl – ein Leopold mit unbekanntem Familiennamen, der wohl einmal im Dorf
als Gärtner bedienstet war, dann aber auf einen fern gelegenen Platz wechselte. Einmal im Jahr kam der Poltl so pünktlich zu Besuch, daß man ruhig den Kalender danach hätte richten können. Er saß dann einige Stunden, ohne viel zu reden, und nur seine ewig verehrte, fesche Rosl anschmachtend.
Der Müllner Franz – Zuname unbekannt, versah die Mühle des Gutsbesitzes. Er war eigentlich immer schlechter Laune. Die Kinder hat er gerne verscheucht. Vielleicht weil sie ihn ab und zu bei gutem Schlaf im Mühlkammerl gestört haben.
Schließen wir mit dem letzten Handwerker des Dorfes, es ist dies
Der Lebmacher Schmied – Er hatte eine Firmentafel, darauf stand Anton Nudl, Huf- und Wagenschmied. Man hat ihn daher mit Herr Nudl oder Herr Meister angeredet. Seine Gesellen
hat man mit Vornamen in Verbindung mit alt/neu, alt/jung, groß/klein bezeichnet oder
einfach die Nudl-Gesellen genannt. Leicht konnte auch der Taufname des Gesellen mit dem
Familiennamen des Meisters kombiniert werden. Was dabei herauskam, war
Der Gaggl Michel von dem wir schon einiges gehört und vielleicht noch zu hören bekommen.
Michael Wohlfahrt
März 25, 2023 um 17:26 | Veröffentlicht in St.Veit | Hinterlasse einen KommentarM e i n L e b e n s l a u f (von Michael Wohlfahrt persönlich verfasst)
Ich bin am 4. September 1900 in Burg Schloßbauer in Freundsam Gemeinde Sörg
Kreis St.Veit/Glan geboren, mein Vater Michael Wohlfahrt, geb. am 8. August 1848
in Friedlach Klockerkeusche, von Beruf freigewerblicher Zimmermeister, meine Mutter
Theresia geb.Strasser am 15. Oktober 1860 in Sörg wurden am 20. November 1899
in der Pfarrkirche Gradenegg getraut.
Im Jahre 1902 übersiedelten meine Eltern vom Schloß zum Oberlercher in Unterholz
ob Gradenegg in ein alleinstehendes Häuschen. Im Jahre 1904 war meine Mutter in
tiefer Trauer, als mein Halbbruder Hois mit 18 Jahren im Krankenhaus St.Veit an einer
Kopfgrippe verstorben war. Dieser Bruder war bei Graf Goess als Kutscher angestellt
und hat als solcher zur Hochzeit des Ehepaares Pluch, Gastwirt in Feistritz-Pulst zu
fahren gehabt, sich dabei in kühler November-Nacht erhitzterweise auf seinem Wagen
schlafen gelegt und so die tödliche Krankheit geholt. Meine Mutter hat oft erzählt, daß
es in jener Nacht in der der Bruder verstorben ist, bei uns angeweilt hätte, daß man
deutlich die Haustür öffnen gehört habe und als sie sich überzeugen wollte, doch niemand
gesehen hat.
Ein Jahr danach, als fünfjähriger Bengel fand ich eines Tages in einem Versteck bei der
Unterdachstiege eine kleine Blechdose, deren Inhalt aus lauter Silbermünzen bestand.
Da die Mutter gerade nicht zugegen war, zeigte ich meinen Fund dem Vater, der nichts
anderes wußte, als damit sogleich ins Dorfwirtshaus zu gehen und spätabends betrunken
heim zu kommen. Die Folge davon war ein schwerer elterlicher Streit in dessen Verlauf
sich herausstellte, daß es sich dabei um Mutters letzte Spargroschen gehandelt hatte.
Noch heute fühle ich mich als Urheber dieser Auseinandersetzung und werde das Gefühl
nicht los, daß zwischen meinem um ein volles Jahr verspäteteten Schuleintritt, weil ich
Stotterer war und der langwährenden Verstimmung im Hause ein Zusammenhang besteht.
Mein erster Lehrer war Alfred Frey. Im zweiten Schuljahr konnte ich eine Abteilung
überspringen und kam zu Oberlehrer Michael Kropf. Im selben Jahr mußten wir
zum Rader in der selben Ortschaft übersiedeln.Noch im gleichen Monat erkrankte ich
hier schwer an Diphtherie (?) An meinem Aufkommen wurde schon sehr gezweifelt.
Daß ich doch wieder meine volle Gesundheit erlangte ist allein dem Umstand zu verdanken,
daß mein Vater für die Graf Goess’sche Gutsverwaltung inmitten des großen Kulmwaldes
Schindel zu klieben hatte, wohin auch Mutter und ich zur Ferienzeit gingen um Vater bei
der Arbeit zu helfen. Dort bauten wir ein ganzes Dorf aus Rundstangen und Baumrinde,
wie Arbeitshütte, Küche, Schlafraum, Ziegen- und Hühnerstall. Außerdem hat Mutter
einen schönen Gemüsegarten angelegt, der uns reichlich Grünzeug lieferte. Die vielen
Wochen in bester Waldluft verhalfen mir wieder zu Gesundheit und gutem Aussehen.
Am 29. September war Vaters Namenstag und daß er auf einen Sonntag fiel ist mir
noch in bester Erinnerung. Es wurde ein Fest in unserem Walddorf gefeiert, an dem auch
Schwester Rosl, die Brüder Peter und Leonhard sowie die Familie Maier aus Gramilach
teilnahmen. Zwei Kisten Bier und Mutters Sorge für genügend Nachschub aus der Küche
waren die besten Voraussetzungen für gute Laune und Zufriedenheit unter den Gästen
inmitten des Waldes bei herrlichen Vogelsang.
Der Natur gehorchend zogen wir im Spätherbst wieder in unsere Stammwohnung zurück.
Als ich dann in diesem Jahr das Abschlußzeugnis nachhause brachte, hat sich die Mutter
sehr gewundert, daß ich durchwegs gute Noten hatte, besonders in Betragen „sehr gut“
wo zuvor immer ein „genügend“ stand. War dies vielleicht eine Parallele zur Besserung
meiner Gesundheit oder der Einfluß des Walddorfes? Ein recht unruhiger Geist bin ich
wohl gewesen. Sollte diese Untugend jetzt für immer überwunden sein?
Anfang des Jahre 1910 wurde Lehrer Alfred Frey wegen antikatholischen Verhaltens
versetzt. Sein Nachfolger Albert Silbert erzählte uns oft von der Grünen Steiermark,
was seine Heimat war. Seine Lieblingsfächer waren Singen und Turnen, auch verstand
er es ausgezeichnet die volle Achtung seitens der Kinder zu gewinnen. (Ich komme
später nochmals auf diesen Lehrer zurück!)
Im Frühjahr nahm Vater die Waldarbeit wieder auf, was sich bis 1916 Jahr für Jahr
wiederholte. Weil ich gesund und immer stärker geworden bin, hatte es Mutter nicht
mehr nötig, Vater im Wald zu helfen, dies wurde jetzt meine Aufgabe. Jeden Mittwoch
nachmittag und an dem freien Donnerstag sowie über die Sommerferien brachte ich
im Wald bei Vater zu. Am Ende des Monats kam Oberförster Gampnig auf die
Arbeitsstelle um sich von der Leistung zu überzeugen und gleichzeitig dem Vater
einen Vorschuß von 50 Gulden oder 100 Kronen auszufolgen. Am darauffolgenden
Freitag nach der Arbeit gingen wir über Woitsch nach Feistritz zum Rieder die Monats-
fassung holen und bei einbrechender Dunkelheit ging es schwerbepackt wieder hinauf
in unsere Waldbehausung. Samstag um 4 Uhr nachmittag, wenn die Glocken zum
Feierabend erklangen zogen wir von der Arbeitsstätte heimwärts um dort gemeinsam
den Sonntag als Ruhetag zu genießen.
Ein Jahr, das ein besonderes Ereignis brachte, war 1911 – kein erfreuliches, wohl
eher ein beschämendes Ereignis, daß an dem Tage. wo ich in Gradenegg vom Bischof
gefirmt wurde, diese keinesfalls ausreichte und ich von meiner Mutter ein zweitesmal
gefirmt werden mußte. Der Grund dafür war jener, daß ich von der ersten Firmung
berauscht war und nicht mehr allein nachhause gefunden habe. In meiner Dienststellung
als Ministrant hatte ich an diesem Tage schon um 7 Uhr früh in der Kirche zu sein.
Die Einschärfung, vor der Firmung nichts zu essen einerseits, andererseits aber, daß
sich um mich niemand recht gekümmert hat, mögen vielleicht als Milderungsgründe gelten.
Jedenfalls, als ich um ca 11 Uhr mit meinem Firmpaten Ambros Obmann die Kirche
verlassen konnte, nahm mich dieser mit ins Gasthaus Dulle, drückte mir einen 5 Kronen
Taler in die Hand und mußte dann als Musikant auftreten. Auf einmal ganz mir selbst
überlassen, von bischöflicher Feierlichkeit heftig durchdrungen, schuf ich mir eine
halbe Bier an, in völliger Unkenntnis seiner Wirkung, um nach erster Wahrnehmung von
Übelkeit die Gaststätte französisch zu verlassen. Ich schwankte den Weg hinauf bis zum
Schulgebäude des Ortes, wo mich meine Mutter in bewußtlosen Zustande auffand.
Mit Mutters Hilfe kam ich nachhause um bald darauf die zweite Firmung zu empfangen.
Am nächsten Tag wollte ich nicht in die Schule gehen weil ich mich riesig schämte.
Obwohl ich an diesem Vorfall schuldlos war, hatte mir das meine Mutter noch jahrelang
nicht vergessen.
Im November dieses Jahres übersiedelten wir in die Burg Hohenstein und von wo aus
ich die Schule in Pulst zu besuchen hatte. Ich habe mich dort todunglücklich gefühlt und
dies wollte nicht von mir weichen. Es kam so weit, daß ich am 5. Jänner 1912 anstatt
in die Schule nach Pulst, über den Brautsteig in die alte Schule nach Gradenegg ging.
Mein dortiger Lehrer ließ mich mit freundlichem Lächeln in die Klasse eintreten. Um 4 Uhr
war Schulschluß, um aber zuhause nicht aufzufallen, habe ich den Heimweg mehr
im Laufschritt gemacht. Leider hat dies nichts genützt. Als ich heim kam erkannte ich
schon an den Minen meiner Eltern was los war. Die Deutlichkeit nahm noch zu
als meine Mutter wortlos in den Stall ging um dort die Arbeiten zu verrichten, mein
Angebot zur Mithilfe aber zurückgewies. Vater trat zur Türe und sperrte sie ab.
In Angst verfallen übersah ich ganz, wie Vater mit mir Heiligen drei König Gesang
anstimmte. Es war so schön, daß ich Wasser in den Augen hatte. Abseits gestellt
bekam ich mein Abendessen, das ich unter Schluchzen hinunterwürgte. Habe es mir
wohl reiflich überlegt, noch einmal das Schulgebäude zu verwechseln. Der Vater
sorgte dafür, indem er mich am erstfolgenden Schultag in die Schule begleitete und
den Herrn Lehrer Adalbert Castelitz bat, strenger zu mir zu sein. Ich habe mich teils
aus Angst, teils dadurch, daß ich doch nach und nach meine alte Klasse vergaß, so
weit in Pulst eingewöhnt, daß ich in den nächsten Jahren wieder Vorzugschüler
geworden bin. Als Beweis dafür diene mein Entlassungszeugnis.
In der Freizeit, die von der Schule aus bestimmt war, hatte ich in diesen Jahren bis Anfang
1914 nicht nur im Kulmberg beim Vater Beschäftigung, sondern auch zuhause
viel zu tun. Wir hatten in dieser Zeit 4 Ziegen und jedes Jahr 3 Schweine. Mein
Privatvergnügen bestand aus einer Hasenzucht, wo aber nicht viel dabei herausschaute.
Am meisten trug mir noch an Trinkgeld ein, daß ich die Schloßbesucher in diesem
herumführte und auch einiges davon erzählen konnte. Ob das gerade immer die Wahrheit
war, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Aber das eine war klar, ohne mich konnte
niemand das Schloß von Innen sehen..
In der Silvesternacht von 1913 auf 1914 hat der Vater in seinem Dusl im Ganskragen
700 Gulden verloren. Zusammen mit der Mutter bin ich noch in der Nacht mit der
Laterne die Brieftasche suchen gegangen, aber umsonst. Als Mutter am Neujahrstag
nach Pulst in die Kirche ging, hat ihr die ehrliche Finderin Maria Muralt die gefundene
Brieftasche übergeben. Mutter, von der Ehrlichkeit gerührt, händigte der Finderin
100 Gulden als Finderlohn aus.
Zur selben Zeit ging mein Vater zum Oberlehrer Castelitz und bat für ihn ein Gesuch
an Herrn Grafen Goess des Inhalts und mit der Bitte zu verfassen, das notwendige
Rundholz zu geben, damit Vater davon Schindel klieben und das Wohnhaus in
Hohenstein, wo wir wohnten und es schon auf allen Ecken einregnete, mit Eigenleistung
neu decken könne. Die Wirkung dieses Gesuches war aber eine ganz andere als sie
der Vater in seinem guten Glauben beabsichtigt – oder erhofft hatte: Mitte Feber 1914
kam Herr Oberförster Gampnig zu uns mit der Wohnungskündigung in der Hand und
mit dem festgelegten Räumungstermin 1. März 1914. Der Kündigungsgrund war der,
Vater hätte mit seinem Gesuch den Dienstweg einhalten sollen….
Die Eltern versuchten alles um dieses Unheil abzuwenden. Es war umsonst.
Lediglich der Räumungstermin wurde auf den 15. Juli 1914 verschoben, weil Vater
bei seiner Jahresabrechnung die Miete ein halbes Jahr im voraus bezahlt gehabt hatte.
Ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern und verstehe erst heute, warum Mutter
in diesen Monaten so oft bitterlich geweint hat. Die letzten zwei Jahre waren die
einzigen, wo Mutters unermüdlichicher Fleiß anfing, wirtschaftliche Früchte zu tragen.
Vater mußte monatelang arbeiten um Türen und Fenster und sämtliche Fußböden
neu zu machen, wofür er nichts bezahlt bekam. Drei große Gärten sowie ein 25 m
tiefer Ziehbrunnen wurden von den Eltern geschaffen und als diese Mühen und
ihr Fleiß die richtigen Früchte gebracht hätten, mußten wir alles stehen lassen, nur
weil unsere Schweißtropfen nicht auf eigenen Grund und Boden gefallen sind.
Ich habe nicht die Absicht, etwas zu übertreiben wenn ich erwähne, was meine Eltern
plötzlich und zu billigsten Preisen alles verkaufen mußten weil in der neuen Wohnung
kein Platz mehr dafür war und auch keine Möglichkeit zu weiterer Viehhaltung: Acht
Fuhren Heu – alles auf unseren Köpfen zum Schloß hinauf geschleppt, 1500 kg
Kartoffel, vier Ziegen, drei Jungschweine, 25 Hühner, einen Karren, den
Fleischhimmel, Futterkessel und Backofen,
die Aufzugsvorrichtung für den Ziehbrunnen, die Hobelbank, Kraut- und Fleischfässer,
Gartengeräte und einiges Handwerkzeug.
Zu all dem kam noch die Frage, was mit mir geschehen soll, denn ich wurde am 20.4.
vorzeitig vom Schulbesuch entlassen. Es ging nicht nur die Wohnung, sondern auch für
Vater auch die Arbeit verloren. Mein Halbbruder Peter hat den Eltern vorgeschlagen,
mich als Kellnerlehrling im Gasthof Einsiedler in Klagenfurt Kreuzbergl unterzubringen,
was Vater mit dem Bemerken ablehnte, daß ich vorerst für einige Jahre in bäuerlichen
Dienst treten solle um auch diese Arbeit kennenzulernen um im Falle späterer Rückschläge
mein sicheres Fortkommen zu haben. Aus einem leidigen Zufall sollte sich Vaters Wunsch
bald erfüllen. Am Christi-Himmelfahrts-Tag ersuchte mich mein Schulfreund Josef
Karlbauer, Pächtersohn bei Münzmeister in Radelsdorf, der an diesem Tage eine Kuh
nach Pulst zum Stier führen mußte, ihm dabei behilflich zu sein. Ohne etwas dabei
zu denken, ging ich darauf ein. Als wir nach Pulst kamen, hörten wir beim mittleren
Wirt die Kirchtagsmusik. Wir machten die Kuh im Neubauer Stall fest und gingen
da hin, wo es lustig war. Bei diesem Herumstehen wurde es drei, vier ja sogar fünf.
Jetzt sollte ich zuhause schon längst die Ziegen weiden. Auf einmal verschwand mein
Kollege ohne etwas zu sagen und ich bekam es langsam mit der Angst zu tun. Als
es anfing dunkel zu werden, schlich ich heim. Je näher ich unserer Behausung kam
um so mehr fing ich zu schlottern an. Meine Schlafstelle war am Unterdachboden,
aber ich wagte nicht hineinzugehen, guckte durch das Fenster in die Wohnstube und
sah wie Mutter, Vater und Halbschwester Rosl, die zu Besuch aus Klagenfurt gekommen
war, weil sich ihr 5-jähriger Sohn Hans bei uns in Pflege befand, fröhlich beisammensaßen.
Nach einiger Zeit konnte ich sehen, wie sich Mutter und Rosl zum Fortgehen fertigmachten
und ich ahnte schon, daß sie gehen würden um mich zu suchen. Meine Kehle war wie
abgeschnürt um mich bei ihrem Fortgang zu melden. Wie ich am nächsten Tag von
Mutter erfuhr, führte sie ihr Weg zum Münzmeister, wo sie von meinem Kameraden
hörten, daß er mich in Pulst zurückgelassen hätte. Aber auch in Pulst konnten sie mich
nicht finden. Diese Abwesenheit nützte ich aus, am Dachboden unterzutauchen ohne
daß mich mein Vater bemerkt hat. Als ich aber Mutter und Schwester zurückkommen
hörte, verkrümmelte ich mich abermals und tatsächlich kam Mutter Nachschau halten,
ob ich in meinem Bett sei, was aber nicht der Fall war, weil ich daneben kauerte.
Endlich trat nächtliche Ruhe ein. Am Morgen als Mutter die Türen öffnete war ich
schon wieder weg. Ich sah aber deutlich, wie Mutter besorgt den Unterdachboden
verließ. Während Mutter mit der Stallarbeit beschäftigt war, nahm ich die Sense und
ging mähen. Unterdessen ist Vater wieder fort in die Arbeit und auch Rosl mußte
zum Frühzug. Als die Mutter die Ziegen auf die Weide trieb und meinen fünfjährigen
Stellvertreter, den Hans als Halter mitnahm, erblickte sie mich beim Mähen.
Hier näherte ich mich zaghaft meiner Mutter, bat sie um Verzeihung und durfte dann
nachhause gehen, wo ich mein Frühstück bekam und den Auftrag, mir einen Arbeits-
platz zu suchen, weil der Vater über meine Verfehlung sehr böse sei. Mit besonderer
Aufmerksamkeit hörte ich mir die Lehren meiner Mutter an und nun begann für
mich der Ernst des Lebens.
Noch am gleichen Tage ging ich ohne Ziel von zuhause weg im Gedanken, wohin
wohl der Wind mich blasen werde. Da es aber ein windstiller Tag war, kam ich nicht
weit. Beim ersten Bauer wurde ich schon aufgenommen. Mein erster Brotgeber
war der Bauer Puchreiter. Mit Freude ging ich an die Arbeit und machte mich mit dem
Ziehsohn Franz, Hausknecht Jakob, Milchführerin Mitzl (meine heutige Schwägerin),
der Klara und ihren beiden Kindern bekannt. Vorallem die Bauersleut waren sehr
nett und gut. Es kam der Fronleichnamstag, da gingen wir gemeinsam, ich mit einem
neuen Anzug (Schnürlsamt) mit einer roten Rose im Knopfloch geschmückt, in die
Kirche nach Pulst, wo ich meine Eltern traf. Ich durfte mich darüber freuen, daß Vater
meinen Streich anscheinend vergessen gehabt hatte!!
Als wir bei der Grumetarbeit waren kam eine Frau auf die Wiese und borgte sich von
der Klara den Rechen aus um gleich damit auf Mitzl loszuschlagen. Diese Handlung
erstaunte mich sehr. Wie ich erst später erfuhr, war es Mitzels Mutter (meine spätere
Schwiegermutter). Die Ursache dafür soll darin gelegen haben, daß sich Mitzl mit einem
gewissen Martin des öfteren unterhalten haben soll, von welcher Unterhaltung Willi
Sittlinger stammt.
Ich erinnere mich noch heute gerne an diese Monate und weil es mir sehr gut ging
habe ich ganz übersehen wie es Weihnachten wurde. Meine Bauersleute wollten von
einem Platzwechsel meinerseits nichts wissen. Die 5 Kronen Leihkauf, die mein Vater
von der Münzmeister Bäurin für mich angenommen gehabt hatte, wollten die Puchreiter
durch einen Boten zurückerstatten. Wegen der bekannt schlechten Verhältnisse auf
dem Münzmeisterhof hat man dort sehr schwer Arbeitskräfte bekommen. Aus
diesem Grunde lehnte die Münzmeisterin die Rückerstattung des Leihkaufes kurzerhand ab
und bestand darauf, daß ich die Vereinbarung welche mein Vater für mich getroffen
hatte auch einhalte. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich nur beim Puchreiter
bleiben wollen. Das letzte Wort hatte aber mein Vater und es lautete, wenn ich nicht
zum Münzmeister ginge, die Verpflichtung, die er für mich eingegangen, nicht einlöse,
dann darf ich mich in Zukunft mit keiner Wäsche oder in sonstiger Angelegenheit
zuhause blicken lassen. Dieser Anweisung nachzukommen habe ich meinen guten
Dienstplatz am 30.12.1914 gewechselt mit 30 Gulden Abrechnung und mit der
Zusicherung, daß ich zu jeder Zeit wieder aufgenommen werden würde.
Ich will dieses Jahr nur ganz kurz streifen, da wenig Erfreuliches zu vermerken ist und teils
wohl auch schon den Kriegsauswirkungen zuzuschreiben wäre. Anfang März 1915 besuchte
ich Bruder Peter in einem Lazarett in Klagenfurt. Er kam mit einer Fußverwundung von
der russischen Front. Im übrigen gab es durchwegs schwere Arbeit und schlechte
Verpflegung. Mutter hat später immer wieder von dieser Zeit gesprochen und erzählt,
daß jedesmal wenn ich heim kam meine erste Frage lautete, ob etwas zu essen für mich
da sei. Vaters Willen zu entsprechen, habe ich ein Jahr lang durchgebissen und seine Zusage
erlangt, meinen Platz zu den nächsten Weihnachten verändern zu dürfen. Mein Jahreslohn
für 1915 betrug 50 Gulden.
Im Jahr 1916 kam ich auf Gut Kraindorf. Diesen Posten hab ich mir selbst ausgesucht.
Schon bei der Lohnvereinbarung wurde mir ein Jahreslohn von 60 Gulden zugesichert,
es blieb aber nicht dabei, werde das am Ende des Jahres in meinen Schilderungen noch
aufzeigen. Schon in den ersten Tagen konnte ich erkennen, daß meine neue Lage in
keinem Vergleich zu jener des Vorjahres stand. Mir wurde die Betreuung des Jungviehs
übertragen und ich habe schon in der ersten Zeit einiges nachgeholt. Es wurde Streu
besorgt, das Vieh täglich geputzt, die Fenster gewaschen, wo Stroh in den Fenstern war,
Glas eingesetzt, der Stall sauber und rein gehalten und so Vertrauen und Anerkennung
erworben. Auf Grund dessen kam ich im Laufe des März in den Pferdestall, wo sich
meine Arbeitsfreude noch steigerte. Es gelang mir, meinen Eltern jede zweite Woche
einen Laib Brot zu bringen, da ich sah, daß die Lebensmittelknappheit immer drückender
wurde. Eines schönen Tages im Mai wurde ich zu meiner Dienstgeberin gerufen, die mir
die Frage stellte, ob es wahr sei, daß ich meinen Eltern Brot bringe. Kurz überlegt, ob
ich dies in Abrede stellen solle, blieb ich bei der Wahrheit und bejahte. Darauf sagte
die gute Frau, daß ich jung bin, das Brot selber brauche und um nicht von Kräften zu
kommen, werde von nun an das Brot für mich ausgeteilt werden und für die Eltern könne
ich jeden Monatsersten den für sie bestimmten Laib holen. Dabei blieb es dann auch.
Das ganze Jahr hindurch war ich mit Freude bei der Arbeit und habe den Krieg in
keinster Weise gespürt. Obwohl es mir sehr gut ging, glaubte ich, meinen Vater daran
erinnern zu müssen, daß er mir nach Erfüllung seiner Bedingungen versprochen hatte,
einen Beruf erlernen zu dürfen. Es war lediglich noch die Frage wo? wie? und was?!
Meine Dienstgeberin versuchte wiederholt, mich von meiner Idee – zumindest so lange
es noch Krieg gebe – abzubringen. Doch was ein Dickkopf ist, bleibt ein Dickkopf!
Es ist kaum zu glauben, doch obwohl ich ab Neujahrstag 1917 meinen guten Dienstplatz
sicher gehabt hätte, trieb es mich mit Gewalt zum Abschied. Da erhielt ich zu meinem
größten Erstauen sage und schreibe einhundert Gulden Jahreslohn ausbezahlt. Ich dachte
mir, das sei jetzt der Grundstein zur Erlernung eines Berufes und dieser Gedanke führte
mich heim zu meinen Eltern.
Nach zweieinhalb Jahren wieder daheim, war mit mir ein sichtbarer Wandel erfolgt.
Mein erster Kauf den ich machen durfte und was ich mir auch lange schon sehnlichst
wünschte war ein komplettes Laubsägewerk, wobei mir mein Vater in den Anfangs-
begriffen behilflich sein konnte. Mein erster Versuch um einen Lehrposten bei den
Treibacher Chemischen Werken war erfolglos. Mit meinem Freund August
Stückelberger das gleiche Ziel verfolgend kam ich nach der ersten Enttäuschung
auch zum Bergwerk Sonnberg und baten um Einstellung. Der Bergdirektor, der
sich unser annahm, sagte uns, sie bräuchten Arbeiter in der Grube, aber für so blutjunge
Menschen wäre es wirklich zu schade in die Grube zu gehen und schon gar in Ermangelung
des für junge Leute notwendigen Fettes. Er würde uns anraten, über die Zeit des
Krieges in bäuerlichen Dienst zu gehen wo es noch etwas zu essen gibt. Dieser Rat
hat mir jetzt um so mehr zu denken gegeben, weil ich ihn schon zum zweitenmal zu
hören bekam. Als wir aus dem Bürohaus traten, fuhren auch gerade die Bergknappen
aus der Grube. Im ersten Moment erschrak ich sehr, rabenschwarz die Gesichter und
die Hände. Da habe ich des Bergdirektors Aussage erst so recht verstanden.
Ende Jänner erhielten wir von Bruder Leonhard einen Brief, worin er sich auch erkundigt,
was ich zu machen beabsichtige und ob ich nicht den Schlosserberuf erlernen möchte.
Es würde ihm sicher gelingen, mich in den Steyr-Werken, in welchen er beschäftigt ist,
als Lehrling unterzubringen. Wir sollten ihm unsere Meinung bekanntgeben. Als ich das
las, hätte ich am liebsten einen Luftsprung gemacht. Gleich am nächsten Tage ging ich
nach St.Veit zur Bezirkshauptmannschaft um einen Reisepaß – denn Kärnten galt als
engeres Kriegsgebiet – den ich schon am 10. Feber 1917 zugesandt erhielt. Am 12. Feber
fuhr ich bereits nach Steyr ab. Es war ein Samstag. Am ersten Tag kam ich bis Klein
Reifling. Dort hieß es aussteigen und bis 6 Uhr früh auf den Anschlußzug warten. Also
hinein in den Warteraum um vor der beißenden Kälte Schutz zu finden. Leider kein
warmer Ofen und selbst der hätte nicht viel geholfen, weil sämtliche Fensterscheiben
fehlten. Gänzlich unerfahren und alleine stand ich da. Eine zeitlang weinte ich vor Kälte
und Heimweh. Endlos schien mir die Nacht. Um 6 Uhr kam endlich der Zug mit dem
ich weiterfahren konnte. Mein Bruder wohnte zu dieser Zeit auf dem Lande in
Unterdambach, Post Garsten. Mir war nur diese Anschrift bekannt und ich wählte daher
die Endstation Garsten, wo ich um ca. 7 Uhr früh ankam. Zu meiner Überraschung
mußte ich hören, daß ich um 5 km zu weit gefahren sei und nun die Strecke zu Fuß
zurückzugehen hätte. Der Schnee knirschte unter meinen Schuhen, der Wind pfiff
mir kalt und brennend ins Gesicht. Nach eineinhalbstündigen Marsch klopfte ich am
Hause Unterdambach Nr.28 an. Auf den Herein-Ruf trat ich in die Küche, wo die
Schwägerin Fany (od.Toni?) gerade beim Frühstückkochen war. Auf die Frage,
was ich wünsche, war meine schüchterne Gegenfrage, ob hier ein Leonhard Moser sei.
Die Türe ins Schlafzimmer war ein wenig offen und der Bruder hatte mich sogleich
an meiner Stimme erkannt. Er forderte mich auf, sofort einzutreten. Nach unserer
Begrüßung wurde Fany gleich freundlicher, sie hatte mich zuvor ja nie gesehen gehabt
und weil ein früher Besuch am Sonntag Morgen eher selten vorkommt, war die Schwägerin
gegen mich zuerst mißtraurisch. Das dauerte aber nur kurz und ich wurde sehr lieb aufgenommen.
Mit der kleinen Fany, die sehr zutraulich wurde, konnte ich mich rasch anfreunden.
Im Verlauf des Vormittags war ich voll Übereifer bemüht, vom Bruder herauszufinden,
welche Möglichkeiten er für mich sieht. Er meinte, die Aussichten für einen Lehrplatz
seien nicht besonders gut. Als es Abend war gingen wir bis auf die kleine Fany, die
schlafen ging, gemeinsam in einen großen Gasthof. Mein Bruder hat mir dort einen
Platz angewiesen und bedeutet, daß in diesem Raum das Theaterstück „Der Einsiedler“
zur Aufführung gelangen wird und dabei die Schwägerin als Sängerin und er der
Bruder als Holzschnitzer mitwirken werden und er hoffe, es würde mir gefallen.
Man ließ mich allein zurück und wie ich merkte kamen mehr und mehr Gäste, darunter
sehr viele Offiziere aus der nahen Kadettenschule. Nach einiger Zeit ertönte ein
Glockenzeichen, im Saal wurde es immer finsterer. Es folgte eine unheimliche Stille
und schon sah ich, wie sich der Vorhang hob. Auf der Bühne war ein alter Mann,
auf einem derben Stuhl sitzend während er auf einem Stück Holz herumschnitzte.
Er stand auf, ging einige Schritte aufs Publikum zu und sprach ein paar Worte zu uns,
da erkannte ich den Bruder an seiner Stimme. Riesig angespannt verfolgte ich den
weiteren Verlauf der Darbietung. Das erstemal in meinem Leben lief ein Theaterstück
vor meinen Augen ab und es hat mir nur sehr leid getan, daß Vater und Mutter nicht
die Möglichkeit hatten, sich daran zu erfreuen.
Am Morgen des 13. Feber 1917 erwachte ich und fragte alsbald nach dem Bruder.
Fany sah mich sehr freundlich an und meinte, daß ich sehr gut geschlafen und ganz
überhört habe wie Leonhard in die Arbeit ging. Ich solle mich von der Fahrt erholen
und morgen früh geht es nach Steyr. Um 7 Uhr früh anderntags fuhren wir mit dem
Arbeiterzug nach Steyr. Dort zeigte mir der Bruder die Fabriksanlagen, erklärte mir
die einzelnen Objekte und sagte schließlich bei Objekt 9 müsse ich um 8 Uhr am
Eingangstor sein und wenn ein Mann in blauem Mantel kommt, das sei dann der
Betriebsleiter. Ehe sich Leonhard von mir verabschiedete wurde noch vereinbart
uns um 12 Uhr im Gasthaus Buchenwald zu treffen. Um ja nichts zu übersehen,
hielt ich das Eingangstor scharf im Auge. Es dauerte nicht lange, da erblickte ich
den Betriebsleiter wie beschrieben, zog weit ausgeholt vor ihm meinen Hut, grüßte
höflich und trug ihm gleich meine Absicht vor. Er sah mich eine zeitlang groß an, fragte
mich von wo ich komme. Ich sagte, von Kärnten. Da fuhr er fort, wie man so ungeschickt
sein könne, ziellos drauflos zu fahren. Die Betriebsleitung der Steyr-Werke habe keine
Absicht, Lehrlinge einzustellen, sie brauchen ausgebildete Fachkräfte und man kann
solche zur Genüge unter den Kriegsinvaliden und Kriegsgefangenen bekommen.
Ich bedankte mich und der blaue Mantel verschwand im Tor. In den Vormittagsstunden
trieb ich mich zwischen den Fabriksanlagen herum. Plötzlich schreckte mich eine
heulende Sirene, fast zeitgleich eine Dampfpfeife. Es war 12 Uhr und aus allen Toren
drängten sich Menschenmassen auf die Straße, verteilten sich nach allen Richtungen
hin. Autos mußten anhalten. Die nachströmende Menge wollte kein Ende nehmen.
Im besagten Lokal traf ich meinen Bruder wieder, ich berichtete ihm von meinem
Mißerfolg und auf meine Frage, wieviel Arbeiter es hier überhaupt gibt, antwortete
er mir leise, zwölftausend Mann. Solche Versuchsgänge wiederholte ich noch dreimal,
zu meiner tiefen Enttäuschung ergebnislos. Ich mußte aufgeben und fuhr am 19. Feber
um 1/2 8 Uhr früh wieder heimzu. Um 5 Uhr abends in St.Michel angekommen, kam
die Zugskontrolle. Ich zeigte meinen Reisepaß. Man sah denselben durch und steckte
ihn in die Diensttasche. Als der Waggon durchkontrolliert war wurde ich aufgefordert,
den Beamten zu folgen. Ich wurde dem Stationskommando übergeben und in den
Warteraum verwiesen. Um 1 Uhr in der Nacht wurde ich geholt, bekam meinen Reisepaß
mit Vermerk „Rückreiseerlaubnis für 20. Feber 1917“ zurück. Um 7 Uhr früh war
ich endlich wieder zuhause. Noch am selben Tag besuchte ich meine Mutter beim
Schober in Pulst, wo sie auf Störarbeit war mit Wollespinnen, die der Weber zur
Lodenerzeugung brauchte. Die Mutter war sehr erfreut daß ich wieder da war, ich
jedoch noch viel mehr, weil ich vom Heimweh wieder geheilt war. Vater hingegen
hatte zur selben Zeit auf Gut Karlsberg größere Binterarbeiten übernommen und als
er mit der Arbeit begonnen hat, konnte auch ich in diese Störarbeit mitgehen. Wir
waren so einige Wochen beschäftigt, da kam es mit Julius Gaggl Maschinenbau-
werkstätte zu einem Lehrvertrag. Nach Inhalt dieser Vereinbarung trat ich am
1. April 1917 dort in die Lehre. Die Arbeit des ersten Tages bestand darin, aus dem
Bachbett des Lebmacher Baches Schotter in das Fundament zu führen worauf
anschließend der Zubau für die Schmiede entstand. Im Laufe dieses Monats – ich kann
mich noch gut erinnern – zog Familie Valent im heutigen Gasthaus Gaggl in die Wohnung
ein. Sie kam aus der Internierung von der Oststeiermark zurück. Zu dieser Zeit war
Wuttes Vater Bürgermeister, der den Turbinenbau für seine Holzindustrie plante und
dazu einen leitenden Fachmann benötigte. Maurermeister Valent leitete diesen Bau
bis zu seiner Vollendung. Da habe ich mich mit den Angehörigen dieser Familie bekannt
gemacht. Der kleine Sepp, der so wunderschöne blonde Locken hatte wie unser Walter,
dann Franz, Anna, Tilly sowie die Mitzl, die ich schon vom Jahr 1914 her kannte. Wie
mir Mitzl erzählte, waren ihre Geschwister Frieda und Engelbert noch in der
Oststeiermark zurückgeblieben, die ich also nur vom Hörensagen kannte.
Ich hatte mich auf meinem Lehrplatz kaum eingelebt, sprach der Maschinenschlosser-
meister Josef Hochrinner, der im Nebengebäude der Lebmacher Bahnhofsrestauration
eine gut eingerichtete Werkstätte hatte, bei meinen Eltern vor, um mich bei ihm in die
Lehre zu geben. Ich teilte dies meinem Meister mit, der nichts besseres wußte als
seinen Konkurrenten wegen Geschäftsstörung zu klagen. Wie der Fall schließlich
ausging, konnte ich nie erfahren. Die Entscheidung traf jedenfalls mein Vater und
sie fiel gegen Hochrinner aus, weil in dessen Werkstätte jeden Sonntag vormittag
gearbeitet werden mußte und Vater darin eine religionsfeindliche Haltung erblickte.
Weil Vater solches verurteilte und nicht erkannte, daß ich mir dort eine fachlich
wesentlich bessere Ausbildung verschaffen hätte können, hatte ich beim Gaggl zu
bleiben. Dafür verbrachte ich im ersten Lehrjahr zwei Drittel meiner Arbeitszeit
bei Feldarbeiten, auch war die Werkstätte kläglich eingerichtet und erst nach und
nach modernisiert worden. Als die dreimonatige Probezeit abgelaufen war, äußerte
sich mein Meister, daß er mit mir zufrieden sei und daß jetzt der Vertrag voll in Kraft
trete. Weil ich bis dahin mein Bett noch zuhause hatte, war es nun der Mutter Meinung,
daß jetzt, wo mein Lehrverhältnis gesichert sei, mein Meister auch verpflichtet wäre,
mir Unterkunft zu geben. Zu meinem persönlichen Nachteil kam es auch dazu und
so haben mich meine Eltern ohne Bedenken diesem Ausplünderer in die Hand gegeben.
Ich werde die Beweise dafür später noch anführen.
Im Feber 1918 bekam ich den ersten Musterungsbescheid. Diese wurde im Hotel Stern
durchgeführt. Meine Person und Hugo Zlepnig vlg.Kobald in Liebenfels, wir beide
waren für den Militärdienst untauglich erklärt worden. Der Wagner Xander,
Schüttelkopf Heinrich Sekretärsohn, Gauglhofer Hans Sohn des Gendarmerieposten-
führers und Wohlfahrt Peter, Graditzersohn in Glantschach waren alle tauglich.
Ich mit meinen 17 einhalb Jahren fühlte mich gekränkt darüber, daß ich nicht
Soldat werden konnte…..
Bruder Peter wurde im Monat Feber im Karstgebiet der italienischen Front neuerlich,
diesmal sehr schwer verwundet und kam in ein Lazarett nach Wien zur Behandlung.
Ein Teil seiner Hirnschale mußte mit einer Silberplatte ersetzt werden. Nach seiner
Entlassung aus dem Wehrdienst nahm er im April eine Verwalterstelle in Schloß Lind
bei Karnburg an, die aber von kurzer Dauer war, weil er sich im Oktober schon
mit der Mesnerin von Stegendorf, die einen kleinen Besitz hatte, verheiratete.
Anfang November 1918 war das Ereignis des Kriegszusammenbruches und durch
drei Wochen hindurch unsere Straße mit rückflutenden Truppen besetzt. Die Aus-
wirkungen dieses Kriegsendes standen aber wohl in keinem Vergleich mit dem
heutigen. Ich hoffe, daß ich dies noch zur Niederschrift werde bringen können.
Mit Anfang des Monats Dezember mußte ich vom Meister eine Dreschgarnitur
übernehmen und einmal mit dieser vertraut gemacht, damit von Haus zu Haus ziehen
um vorführweise den Ausdrusch des Getreides zu bewerkstelligen. Bei solcher
Gelegenheit kam ich sogar auf Schloß Hollenburg bei Ferlach, welches Gut ein
gewisser Koller, Kriegsinvalide als Verwalter führte, den ich im Jänner 1946
im KZ Wolfsberg wiedertraf. Verpflegungsmäßig ging es mir dort miserabel und
ich war gezwungen, zur Selbsthilfe zu greifen. Darauf, daß dies nicht richtig war,
komme ich noch zu sprechen. Diese Gutsführung hatte bei Kriegszusammenbruch
große Mengen Treibstoff gesammelt gehabt und war daher in der Lage, diesen
Treibstoff für die Druscharbeit bereit zu stellen. Dies bot mir die verlockende Möglich-
keit, Treibstoff abzuzweigen, der als Leuchtöl genug Abnehmer fand und so meine
tägliche Essensration zu sichern. Ich will in dieser Schilderung meinen Kindern auf-
zeigen, wie unrichtig ich gehandelt habe, daß aber die Ursache dafür in meiner
Erziehung lag, die nur auf strickte Folgsamkeit und Unterwürfigkeit bedacht war.
Die Folge davon ist es, daß man im Falle unmenschlicher und ungerechter Behandlung
nicht rechtzeitig den Mut hat, sein Recht zu fordern, sondern eher auf abwegige Art
sein Lebensrecht zu erhalten versucht. Wäre ich nur an diesen Gutsverwalter
herangetreten, eine ausreichende Verpflegung gefordert und erforderlichenfalls
den Drusch eingestellt und meinen Meister informiert, ich bin mir sicher, lieber
als die Arbeit abbrechen zu lassen hätte man mich ausreichend verpflegt. Aber nein,
ich habe mir das gefallen lassen und lieber eine strafbare Handlung gesetzt.
In diesen Wochen meiner Beschäftigung in Hollenburg besuchte ich eines abens in
Lampichl die Familie Karlbauer, bei der ich 1915 als sie bei Münzmeister in Radelsdorf
Pächter waren in Dienst stand. Weil man in Lambichl einen Besitz erwarb, ist die
Familie 1917 dorthin übersiedelt. Der Sohn, er war auch mein Schulfreund gewesen,
lud mich am selben Abend zu einem Theaterbesuch nach Klagenfurt ein. Das war
für mich eine große Überraschung. Erstens, das Gebäude in seiner Innengestaltung
und zweitens die Aufführung „Der Ochsenhandel“.
Nun kam das Jahr 1919 wo ich schon sehr viel selbständig auswärts arbeiten mußte,
besonders bei Motorstörungen, was immer mein Lieblingsfach war. Währenddessen
hielt sich mein Geselle Franz Schummi, der hauptsächlich auf Holzkonstruktionen
eingearbeitet war, fast nur in der Werkstätte auf.
In diesem Jahr habe ich etwas an Gleichgewicht hinsichtlich meiner moralischen Haltung
verloren. Etwas wirkte dabei wohl auch die gesellschaftliche Unordnung in der Zeit
der italienischen Besatzung mit, die ihren Nährboden im verlorenen Krieg hatte,
anderseits die führungslosen, jugendlichen Gedanken. Ohne meinen Eltern Vorwürfe
machen zu wollen, erstens leben sie nicht mehr und zweitens waren sie schon zu alt,
um mich in die richtigen Bahnen zu lenken. Sie nahmen an, daß man mich auch außerhalb
der Arbeitszeit in Obhut nehmen würde und in ihrem gerechten Denken ahnten sie nicht,
in welche Hände ich kam. Von meinem Dienstgeber wurde ich nur als Arbeitskuli
behandelt und die Meinung meiner Mutter von 1917 (ich habe dies in jenem Jahr
wörtlich eingetragen) hat sich insgesamt in zwei Richtungen hin sehr nachteilig für mich
ausgewirkt. Fürs erste wurde meine Arbeitszeit so sehr ausgedehnt, daß ich öfter schon
glaubte, sie würde gar kein Ende mehr nehmen. Zum andern wuchs ich wie ein
Wildling ohne Veredelung ins Leben hinein, was in den folgenden Jahren auf Gemüt und
Seele wirkte. Schon im Jahre 1920 entstand der Name „Norbert“. Meine Zeilen sollen
nicht dazu dienen, einiges für mich vielleicht Unangenehmes zu verschweigen, nein!
Meine volle Absicht ist die, daß meine Kinder aus den Fehlern die ich gemacht habe,
lernen um in ihrem eigenen Leben rechtzeitig zu erkennen und solchen Gefahren aus
dem Wege zu gehen. Ich werde zu verhindern wissen, daß eines meiner Kinder
jemals als Ausnützungssubjekt angesehen wird.
Ich klagte öfters meinen Eltern über meine Lage und immer wieder hörte ich das
bekannte Sprichwort, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. So biß ich von neuem wieder
die Zähne zusammen und endlich nahte der 1. April 1920. Immer gespannter wartete
ich auf das große Ereignis, freigesprochen zu werden. Diesen Gedanken verfallen,
übersah ich ganz, daß dieser Tag ohne die kleinste Freude verlief. Als ich keinerlei
Anerkennung merkte, fuhr ich nach Villach zu Dr.Cäsar von Wayr, seines zeichens
Bahnrat. Ich bekam sofort die Zusage zur Aufnahme. Wieder zuhause kündigte ich
meinem Meister, der aufsprang wie ein gereizter Tiger und mich anschrie, das sei
der Dank daß ich ihm jetzt wo ich etwas leisten könnte den Rücken kehre. Voll
Schwäche und Minderwertigkeitsgefühl überlegte ich und nahm die Kündigung
wieder zurück. Immerhin war ich jetzt frei und durfte auf mehr persönliche Anerkennung
hoffen, wenn ich als Geselle weiterarbeitete. Im nächsten Monat übernahm ich beim
Grentsch in Pach den Bau eines Kraftwerkes für Maschinen-, Mühlen- und
Lichtmaschinenantrieb wo ich völlig selbständig war und mit ganz besonderem
Ehrgeiz die Anlagen montierte. In insgesamt 8 Wochen ist mein Meister nur zweimal
zur Kontrolle nachgekommen, welche jedesmal eine Dauer von einer Stunde hatte
und keine einzige Beanstandung ergab. Mein zu dieser Zeit festgelegter Tageslohn
war mit 200 Kronen vereinbart. Ich werde auf die Lohnproblematik noch zurück
kommen, weil ich alles erst im nächsten Jahr erfahren habe.
Dem Jahre 1921 will ich meine besondere Aufmerksamkeit schenken, weil mich das
Schicksal zu besseren Erfolgen führte. Im Monat März erhielt ich die Verständigung,
daß ich bei Meister Wogatei in Pöckstein mein Gesellenstück zu machen habe.
Am angesetzten Tage habe ich mich dort vorgestellt, wurde in die Werkstätte zu
meinem Arbeitsplatz geführt und erhielt den Auftrag, ein Turbinennadel-Steuerhandrad
anzufertigen. Der Anfang um 9 Uhr war wohl sehr schwer, da man in allem fremd ist.
Ich hatte aber besonderes Glück, um 4 Uhr nachmittags konnte ich alles fix und fertig
dem Meister vorlegen. Ausgezeichnet, sagte dieser und wiederholte das Wort ein
zweitesmal, ehe er die Arbeit zu meiner großen Freude mit einem „sehr gut“ beschriftete.
Am selben Abend noch fuhr ich nachhause. Mein eigener Meister betrachtete das
Gesellenstück auffallend geringschätzig, doch meinem neugewonnenen Selbstwertgefühl
konnte dies nichts mehr anhaben. Zu dieser Zeit hatten wir bei August Pirker vlg
Tschadam in Feistritz-Pulst einen Turbinenbau bis auf den Elektroanschluß fertiggestellt.
Eines Tages kam Julius Gaggl von dieser Arbeit nachmittags heim. Auf meine Frage,
ob das Werk schon läuft bekam ich zur Antwort den Auftrag, gleich morgen früh
dort hin zu gehen, es sei nur noch ein kleiner Fehler zu beheben. Bei meinem Eintreffen
an der Baustelle sah ich ein regelrechtes Knäuel von Drähten und wie mir der Bauer
erzählte, daß Meister Gaggl direkt ins Schwitzen gekommen sei, sich am Ende nicht
mehr auskannte und die Arbeit schleunigst verließ. Um die Mittagszeit war ich dann
so weit, daß ich den Betrieb dem Bauherrn übergeben konnte.
Maurermeister Franz Valent hatte in diesem Jahr geschäftlich bei Ferdinand Leeb vlg.
Grentsch in Pach zu tun. Bei dieser Gelegenheit erkundigte sich der Bauer Grentsch
über mich, ob ich noch bei Gaggl sei und äußerte sich zufrieden über meine seinerzeitige
Arbeit. Die Rechnung darüber lag ihm aber noch ein Jahr danach schwer im Magen, und
er glaubte ich müsse nach seiner Meinung einen hohen Tageslohn haben, denn seine
Rechnung lautete auf 1.000 Kronen pro Tag. So stellte sich unter Beweis, daß es sich
hier um einen regelrechten Betrug handelte, wenn mein Meister auf Grund meiner täglichen
Leistung 800 Kronen pro Tag in seine Tasche steckte.
Es gibt Launen in der Natur und im menschlichen Leben. Obwohl es schon Herbst war,
hörte das stürmische Regenwetter einmal auf und der 6. Oktober 1921 – ein Sonntag,
bot den herrlichsten Sonnenschein in der Natur wie auch in meinem Herzen. Wie es
alljährlich in unserer Gegend der Brauch war, so auch heuer, daß alt und jung zum
weitum bekannten Wiesenmarkt nach St.Veit eilte. Es trachtete wohl jeder, daß er
dabei nicht fehlte, so auch ich. An diesem Tag hab ich mich um die Mittagszeit
fertig gemacht und ohne besondere Ahnung ging ich von zuhause weg. Auf der
ersten Straßenkreuzung traf ich auf die geschlossene Familie Valent, die ganz offen-
sichtlich das gleiche Ziel vor Augen hatte. Wir begrüßten einander und zu meiner
freudigen Überraschung konnte ich dabei das Fräulein Friederike kennenlernen und
ihr zum erstenmal die Hand zum Gruß reichen. Bei dieser Gelegenheit kam mir der
Gedanke, die Erlaubnis einzuholen, mich als Begleiter aufdrängen zu dürfen. Nur ein
stilles Kopfnicken und ein sonderbarer Blick waren sichtbare Zeichen, daß ich nicht
unangenehm gekommen bin. Nach einer Stunde Fußmarsch sind wir am Wiesenmarkt
angekommen, wo es sehr lustig zuging. So weit meine Mittel reichten, ließ ich mich zeigen
und wir übersahen in diesen heiteren Stunden ganz, daß es inzwischen 12 Uhr nachts
geworden war. Gemeinsam traten wir den Heimweg an. In etwas aufgeregter Stimmung
legte ich mich zu Bette und konnte den Gedanken nicht mehr los werden, zu einem
Entschluß zu kommen, hier in vollstem Ernst zu handeln und mannhaft zu sein. Trotz
meiner Jugend traf ich die Entscheidung von solcher Tragweite hinsichtlich Recht und
Glück, sodaß ich heute und in diesen Stunden noch Kraft daraus schöpfe:
Im Jahr 1922 kamen einige erhöhte berufliche Aufgaben an mich heran, wie der
Kraftwerksbau beim Schober in Pulst, wo Hoi Karl als neuer Lehrling mir zur Seite
gegeben war. Es folgte der Obstpresse-Bau bei Herrn Wutte in Lebmach.
Ganz überraschend ergab sich am 15. August mit Friederike allein ein Ausflug nach
der Burg Hochosterwitz. Abends um 7 Uhr in Lebmach angekommen, begegneten
wir bei der unvergeßlichen Straßenkreuzung den Eltern meiner Begleiterin, die uns
ohne ein Wort zu sagen prüfend ansahen. Bei unserem Abschied kam die Frage, ob
ich heute noch zu einem Besuch komme und ich sagte zu. Bei mir zuhause wartete
ein guter Bekannter namens Schwedisch, der einige Jahre mein Schneider war.
Er überredete mich zu einem Kirchtagsbesuch in Pulst und ohne viel nachzudenken,
entschloß ich mich dazu. So habe ich meine Freundin gleich nach zwei Richtungen
hin enttäuscht. Ich bereute meine Handlungsweise bald sehr, jedoch es war zu spät.
Einen Zufall wollte ich nützen und als am Mittwoch den 18. August abends beim
Gregerle der Kalkofen angeheizt wurde, gingen Friederikes Eltern diesen Vorgang
anschauen. Diese Abwesenheit nützend, faßte ich Mut und versuchte mit einer
Entschuldigung eine Versöhnung herbeizuführen. Die Abweisung, die mir zuteil wurde,
lautete in etwa, man wünsche nichts mehr mit Falschheit zu tun zu haben. Einigermaßen
betrübt mußte ich die Wohnung wieder verlassen, erkannte den Ernst der Lage, gab
aber die Hoffnung trotzdem nicht auf.
Schon in den nächsten Tagen wurden die Vorbereitungen für den Lebmacher Kirchtag
getroffen und da gab es immer viel zu tun um den Ansprüchen der zu erwartenden Gäste
gerecht zu werden. Sonntag vormittag mit schmetternder Musik zog der Umgang
feierlich durch das Dorf. Mit einiger innerer Unruhe begann ich mich als Schankkellner
vorzubereiten, um dem ersten Ansturm der Durstigen standhalten zu können.
Am Nachmittag rief mich mein Meister und ich bekam den Auftrag, Herrn Valent
zu holen, Herr Kandussi wünsche ihn in seiner Tischgesellschaft. Nach kurzem
Überlegen führte ich den Auftrag aus. Mit ernster Miene, die meiner inneren Verfassung
entsprach, trat ich bei Familie Valent in die Küche, überbrachte den Wunsch des Herrn
Kandussi und wollte wieder gehen. Im Vorhaus wurde ich von Friederikes Mutter zur
Rede gestellt und gefragt, was zwischen uns vorgefallen sei, denn alles freue sich auf
den Kirchtag, nur ihre Tochter Friederike sei traurig, und heute ganz besonders.
Ich war über diese Frage sehr erstaunt, blieb jede Antwort schuldig und fragte lediglich,
wo sich Friedrike aufhält. Als mich die Mutter daraufhin ins Zimmer führte, sah ich
Friederike tatsächlich in Arbeitskleidung betrübt vor mir. Die Mutter verließ den Raum,
wir blieben alleine zurück. Eine zeitlang schnürte es mir meine Kehle zusammen, weil
ich wohl wußte, daß ich wortbrüchig gewesen war. Wir versöhnten uns schließlich doch
und wir verabredeten, daß ich sie abends zur Kirchtagsunterhaltung abhole. Nach meiner
etwas verspäteten Rückkehr nahm ich meine Schankarbeit wieder auf und als die
Kirchtagsstimmung ihren Höhepunkt erreichte, habe ich mein Versprechen eingelöst,
was mir aber zu einem neuen Verhängnis wurde. Wir gingen einigemale zum Tanz und
es kam zu neuerlichen Vorwürfen. Auf mein Drängen, von wem sie das alles gehört
habe, nannte sie mir nach längerem Zögern den Namen Franz Kersche. Ich bin
erschrocken und wurde zornig. Ich sagte zu ihr, sollte ihre Gunst auf seiten des
Franz Kersche sein, so sollten sich unsere Wege trennen. Ich bin mir in keiner
Weise dieser Anschuldigung bewußt. Daraufhin verließ mich Friederike. In meinem
gesteigerten Zorn dachte ich an Vergeltung. Nach einigen Stunden überzeugte ich
mich über Friederikes Aufenthalt und daß es im Nachbarhaus auch Musik gab.
Mein Suchweg ging also dorthin. Durch das Fenster sah ich das Paar im Tanzen,
jedoch in Friederikes Haltung schien mir ein trauriger Zug. Auf das hin kochte in mir
das Blut. Es dauerte nicht lange, da kam Franz Kersche vor das Gebäude auf die
Straße. Ich stellte ihn zur Rede und anstatt sich zu rechtfertigen lachte er mich hönisch
aus. In diesem Moment hatte ich von meiner Kraft Gebrauch gemacht. Nach einigen
Sekunden flüchtete er zurück in jenes Gasthaus. Nach einigen Minuten stürmte eine
ganze Kolonne hervor. Ich nahm am Zaun Rückendeckung und wartete ab was da
kommen würde. Ich wurde wohl arg beschimpft, mich aber anzugreifen wagten sie nicht.
Inmitten dieses Wirbels sah ich im Dunkeln wie Friederike von ihrer Mutter und
Schwester nachhause geführt wurde. Ich mußte noch mitanhören, daß sie zu ihrer
Tochter sagte „Kränke dich nicht, wenn der Gauner noch einmal in die Wohnung
kommt überschütte ich ihn mit Petroleum und zünd ihn an.“ Das traf mich schmerzlich
und ich mußte mich an ihre Worte vor ca 10 Stunden erinnern. Als meine Bedrängnis
kein Ende nehmen wollte, rief mich Friederikes Vater. Ich meldete mich. Der Vater
trat an mich heran und forderte mich auf, ihn nachhause zu bringen. Auf das hin waren
alle paff. Als ich die Duellstelle verließ und schon am Heimweg war, prüfte mich
Friederikes Vater auf Herz und Nieren und dabei erhielt ich die väterliche Zusage
und wünschte es mir, daß wir uns darüber wieder einig werden.
Nach fünf Tagen erlebte ich die Wirkung, wie wir durch Erhitzung um einige Härtegrade
fester aneinander geschweist wurden. Zur gänzlichen Aussöhnung fuhren wir am
7. Oktober in Begleitung ihrer Schwester Maria nach Brückl zum Kirchtagsbesuch,
wo wir geschlossen im Schlafzimmer der Frau Krasnitzer nach dem Tanz ausruhten und
speisten. Abends fuhren wir nach St.Veit um beim Ausklang des Wiesenmarktes mittun
zu können. Von hier ab leitete uns der aufrichtige Gedanke, alles zu unterlassen, was
unsere Wege irgendwie trüben könnte. Alle künftigen Schwierigkeiten, die an uns
herantraten, trugen wir bereits gemeinsam und so steuerten wir unser Lebensschifflein
mit Freude in die Zukunft.
In diesem Monat hatte ich zu einer Motormontage beim Gregerle in der Werkstätte
die Riemenscheiben anzufertigen. Wegen Betriebswassermangels mußte ich zur
Dreharbeit einen Benzinmotor zuhilfe nehmen. Der Meister ordnete deshalb an, daß
der Lehrling Hoi Karl den Motor bedienen soll. Er sollte sich einschulen um später
selbständig damit arbeiten zu können. Auf einmal ging die Tourenzahl zurück, ich
sah von meiner Arbeit auf und zu meinem großen Schrecken mußte ich erkennen, daß
der Lehrling an der Kleidung vom Schwungrad erfaßt und im Kreis herumgewirbelt wurde.
Ich sprang zum Motor, riß das Zündkabel heraus und im selben Moment flog der
Lehrling im Bogen vom Motor weg. Als ich näher trat um zu helfen, sah ich an Kopf
und Schienbein des Knaben klaffende Wunden. An der Brust waren durch das Ein-
drehen der Kleidung große Hautflächen abgeschürft.
Nach seiner Wiederherstellung, als er die Arbeit wieder aufgenommen hatte und mit
Riemenauflegen beschäftigt war, verfing sich derselbe und drohte sich aufzurollen.
Karl glaubte, er werden den Riemen aus der Schlinge zurückhalten, bedachte nicht
die 2 1/2 PS Antriebskraft, der seinen weit überlegen und als er schon 1/2 Meter
vom Boden weg war und in der Luft baumelte, erblickte ich den drohenden Unfall,
faßte nach ihm und riß in los. So habe ich den Karl ein zweitesmal aus eventueller
Todesgefahr befreit.
Nach kurzem Krankenlager meines Vaters, den die Mutter fürsorglich pflegte, brachte
mir meine Lebenskameradin die traurige Nachricht, daß der Vater am 22. Oktober
gestorben ist. Diese tiefe Anteilnahme war nicht um meines willen allein, sondern die
lag noch tiefer. Die Achtung die sie gegenseitig spürten war schön. Nie hörte ich nur
ein einziges Wort aus Vaters Munde um mich von ihr abzuhalten, sondern ermahnte
er mich viel mehr, die Treue zu halten und wir werden glücklich das Leben gestalten.
Tief ergriffen nahmen wir beide von Vater Abschied. Im Wechsel von Freud zum Leid
und mit diesem naturgewollten Ereignis ging das Jahr 1922 seinem Ende zu.
Der Meister hatte immer noch ein ganz eigenartiges Lohnzahlungssystem und zwar
halbjährlich. Am 1.Jänner 1923 war wieder ein Auszahlungstermin. Bei dieser
Abrechnung bekam ich noch eine Abschlagszahlung von 12.000 Kronen. Als ich das
Geld sah, strahlte ich vor Freude, die aber von kurzer Dauer war. Wie ich in den
nächsten Wochen nach St.Veit kam um meinen Bedarf restlos zu decken, war das
erste ein Hutgeschäft, wo ich suchte und probierte. Als mir endlich ein Hut paßte,
ließ ich ihn einpacken und fragte nach dem Preis. Es hieß 8.000 Kronen. Ich wollte
wissen, ob ich vielleicht falsch verstanden hätte oder es sich um einen Irrtum handle.
Die Verkäuferin meinte, keines von beiden treffe zu, wohl aber sei die Geldinflation daran
schuld. Derselbe Hut kostete vor 6 Monaten 400 Kronen, erwähnte die Verkäuferin
noch sehr höflich. Ich unterbrach das Gespräch, damit der Hut nicht noch teurer werde,
zahlte und machte mich auf den Weg. Aus dieser Erfahrung heraus, daß ich für einen
Hut 40 Tage lang arbeiten mußte, verlangte ich von nun an monatliche Lohnzahlung.
Mit Feber 1923 nahm meine Verlobte bei Baumeister Bulfon in Feldkirchen eine Stelle
an und übersiedelte dorthin. Von dieser Zeit an sah man sich Sonntag nur mehr sehr
selten in Lebmach. Ich lernte dafür Feldkirchen kennen.
All diese Ereignisse bekräftigten mich in meinem Entschluß mein Dienstverhältnis mit
1. April zu lösen. Ich pachtete die Werkstätte von Frau Hochrinner, deren Mann im
Vorjahr verstorben war, meldete mein Gewerbe an und schuf mir den Anfang einer
eigenen Existenz. Mit Arbeitsaufträgen wurde ich förmlich überschüttet, sodaß ich gleich
am Anfang zwei Gehilfen beschäftigen konnte, David Petautschnig und Gottlieb Petutschnig.
So viel versprechend sich meine kühne Unternehmung anließ, so große Schwierigkeiten
traten mir in den Weg. Der Haß und Neid der mir von seiten meines Lehrmeisters
entgegenschlug, stiegen ins unermeßliche. Er wartete nur auf den Augenblick, wo er
zum Dolchstoß ausholen konnte.
Eines Tages kam ich während der Arbeit auf ein Bier in die Gaststube von Frau
Hochrinner, die sich redseelig wie sie war zu mir setzte, erkundigte sich über meinen
Geschäftsverlauf und bei dieser Gelegenheit kamen wir auch auf Meister Gaggl zu
sprechen, mit dem sie – wie mir schon von früher her bekannt war – in dauernder
Feindschaft war. Da glaubte ich, mich einmal ausklagen zu können und erzählte der
Frau, wie mir Herr Gaggl im Jahre 1919 befahl, aus dem Materialmagazin der
Glanregulierung – auf jenem Platze, wo ich für uns im Jahre 1932 ein Wohnhaus
gebaut habe – verschiedene Materialien, wie Stahlstangen, Flach- und Fasoneisen,
Blechtafeln und auch Werkzeuge zu holen. Während meiner Erzählung dachte ich
an keinerlei Auswirkungen. Frau Hochrinner nahm in den nächsten Tagen den
Schimautz Thomas als Boten auf, erzählte ihm von meinen Erwähnungen und
schickte ihn damit zu Meister Gaggl. Nun brannte die Hölle. Binnen 14 Tagen erhielt
ich eine Vorladung zur Ehrenbeleidigungsklage des Julius Gaggl. Mir ist es nicht gelungen,
mit Zeugen zu beweisen, was 1919 geschehen war. Ich fühlte deutlich, wie OLGR Kügler
auf meiner Seite war. Er könne mir aber ohne Beweise nicht helfen. Nach Urteils-
verkündigung stellte Gaggl den Antrag auf Ehrenerklärung in einer Tageszeitung auf
meine Kosten. Die Antwort des Richters lautete, dazu könne er mich nicht verurteilen,
es sei denn ich würde es privat machen, doch glaube er nicht, daß ich so dumm sein
werde. Ich habe zwar keine Niederlage erlitten, doch der Haß loderte weiter. Daß ich
nicht reinen Mund halten konnte, rächte sich bitter. Mit aller Kraft wollte ich mein eigenes
Unternehmen erhalten. Eines Abends nach Arbeitsschluß, die Gehilfen waren schon
weggegangen, nur ich wollte noch auf eine Kundschaft warten, die eine fertige Arbeit
abzuholen versprach. Knapp vor meinem Weggehen besuchte mich der neue Geselle
meines ehemaligen Lehrherrn namens Josef Smolie, da wurde ich vom Nachhausegehen
abgelenkt und wir gingen gemeinsam in Hochrinners Gastwirtschaft. Wir hatten uns
gegenseitig bekanntgemacht und unterhielten uns über berufliche Fragen. Nach kurzer
Zeit gesellte sich ein gewisser Janesch, der beim Wutte in Dienst stand, hinzu.
Um 10 Uhr herum kam die Wirtin Hochrinner, sie habe das Bedürfnis schlafen zu gehen.
Wir stellten uns zum Weggehen bereit, wurden von unserem Vorhaben jedoch von ihr
selbst abgebracht indem sie erklärte, wir könnten etwas Zeche und auch zum Rauchen
anschaffen, sollten ruhig sitzen bleiben, sie übergebe mir den Schlüssel zur Haustür, welche
ich nach unserem Weggehen absperren solle. Bei diesem Vorschlag ist es geblieben.
Um ca. 12 Uhr verließen wir drei das Lokal, sperrten ab und als wir ins Freie kamen,
mußten wir feststellen, daß es eine besonders finstere Nacht war. Bevor wir auf die
Straßenkreuzung kamen, von der ich jetzt die dritte Begebenheit schildere, sahen wir
zwei dunkle Gestalten, die sich trennten. Einer ging Richtung St.Veit, der andere gegen
Hörzendorf zu. Wir haben dieser Beobachtung keine besondere Bedeutung beigemessen,
glaubten, die seien genauso harmlos auf der Straße wie wir drei. Wir verabschiedeten
uns voneinander und jeder ging seiner Wege. Am nächsten Morgen, noch bevor
ich die Werkstätte betrat, stellte ich den Haustürschlüssel zurück. Ich wunderte mich
noch, daß die Wirtin schon auf den Beinen ist, denn sie war als Langschläferin bekannt.
Sie rief mir zu, eine schöne Geschichte, nie wieder wird sie den Schlüssel aus der Hand
geben. Nun wollte ich wissen, was los sei. Es wurde eingebrochen. Gestohlen wurden
ein Nähmaschinenkopf, Gramophon samt Platten, sämtliche Tischtücher. die Wanduhr
und sämtliche Rauchwaren. Als die Frau mit dem Aufzählen endete, war ich mit meinen
Nerven ebenfalls fertig. Ich mußte mich hinsetzen und von diesem Platze weg holte mich
die Gendarmerie. Anschließend gab es eine genaue Hausdurchsuchung. Um 4 Uhr
nachmittag landete ich mit Josef Smolie im Bezirksgerichtsgefängnis in St.Veit.
Nächsten Tag um ca. 9 Uhr wurde ich als erster dem Untersuchungsrichter Dr.Kügler
vorgeführt. Nach meiner Aussage bemerkte der Richter daß er persönlich die Gendarmen
nicht verstehen könne, einen Menschen, dem man vorher den Haustorschlüssel anvertraut,
des Einbruches zu bezichtigen. Ich wäre ein besonderer Pechvogel. Beide wurden wir
sogleich enthaftet. Das Allerschlimmste erlebte ich aber, als ich wieder heim kam.
Alle, sogar meine Freunde gingen mir aus dem Wege. Ich stand der Verzweiflung nahe.
Es kamen die Pfingsten und am Sonntag fuhr ich zu meiner Kameradin nach Feldkirchen.
Sie war von meinem Fall schon unterrichtet, doch unterschütterlich stand sie zu mir und teilte
mit mir alles Leid. An diesem Tage fing ich wieder an, daran zu glauben, daß das Leben
doch noch einen Sinn beinhaltet.
Mein Weiterverbleiben in Lebmach war für eine zeitlang nicht tragbar. So habe ich mir
ein neues Arbeitsgebiet gewählt, das war Glanegg und Mautbrücken, wo ich bis Ende
dieses Jahres Arbeit hatte. In dieser Zeit kam ich einmal beim Zwatte vorbei, der mich
anhielt, weil sein Motor Gefriersprünge am Kühlermantel hatte. Er fragte, ob ich diese
Reparatur an Ort und Stelle machen könne, er habe zwar schon mit zwei Meistern
verhandelt, jedoch keiner gab ihm die volle Garantie. Ich habe ihm voll garantiert und die
Kosten mit 6.000 Kronen vereinbart. Mit der Arbeit haben wir, ich und der Vater von
den Zwillingen Franz und Otto an einem Sonntag um 5 Uhr früh begonnen und um 4 Uhr
nachmittag lief der Motor ohne Störung seinen Probelauf durch. Daraufhin stellte ich
die Rechnung. Bei der Übergabe fing der feine Herr zu brüllen an, nannte uns Ausbeuter
und dergleichen, legte uns 2.000 Kronen auf den Tisch und verschwand wütend.
Die Forderung von 4.000 Kronen ist immer noch offen. Ich habe dies hier angeführt
um Menschen zu charakterisieren. In den Herbstmonaten wanderte meine Kameradin
wieder nachhause. Ganz langsam gelang es mir, innerhalb meines Freundeskreises das alte
Vertrauen wiederzugewinnen und daher konnte uns der 7. Oktober in keiner Weise mehr
verunsichern, sondern mit großer Freude erwarteten wir um 12 Uhr nachts die Ankunft
unseres ersten gemeinsamen Kindes Helene.
(transcribiert und in der Satzstellung da und dort leicht verändert von W.Wohlfahrt im Juni 1999)
Daten aus der Zeit der Internierung:
17.Jänner 1946 Transport-Wolfsberg
7. Feber 1946 Weißenstein – Überstellung
19. August 1946 Ende des Kalenders!?
Von Schwester Grete zur Abschrift bekommen:
Sörg 25.2.1884 Z e u g n i s – womit ich gefertigter Zimmermeister und Keuschenbesitzer zur
Sörg beim Höhbauer hiermit bestätige, daß Michael Wohlfart derzeit in St.Urban, als
Zimmermann bei mir im Jahre 1875 beim Neubau zu St.Paul in St.Urban in seiner
Zimmermannprofession bei mir in Arbeit gestanden und daß (der)selbe als
wohlerfahrener Geselle zu meiner vollsten Zufriedenheit seinem Berufe
nach vollkommen entsprochen hat und jedem Meister aufs beste anempfohlen werden
kann. – Michael Kanatschnig, Zimmermeister – Stempel u. Unterschrift Gem.Sörg
Steuerberg 27.2.1884 L e h r b r i e f Womit ich endesgefertigter Georg Hinteregger,
Keuschenbesitzer und Zimmermeister zu Steuerberg hiermit bekenne, daß Michael
Wohlfart 1849 geboren, katholisch, ledig der Gemeinde Liemberg Bezirk St.Veit
heimatberechtigt durch zwei Jahre das ist von Jänner 1872 bis Ende des Jahre 1873
die Zimmermannsprofision erlernt und dasselbe sich während der Lehrzeit wie es einem
Lehrling geziemt zu meiner vollsten Zufriedenheit in aller Beziehung vollkommen
entsprechend wohlverhalten und in seinem Erlernen sich derart tüchtige Kenntnisse
erworben hat, so daß ich selben bei Neubauten die ich in St.Urban Ende der siebziger
Jahre übernommen als Vorarbeiter aufs Verläßlichste hab hinstellen können, daher ich
den Genannten mit Gewissenhaftigkeit als einen solchen wie ich geschildert jedem Meister und Bauherrn aufs beste anempfehlen kann – Unterschrift u. Gem.Steuerberg Stampiglie.
S o h n M i c h a e l :
Waggendorf 27. Mai 1921 Z e u g n i s Ich Herr Karl Gratzer vlg Strassnig in Waggendorf bin gerne bereit, den Michael Wohlfahrt, Mechanikergehilfe bei Herrn N. Gaggl in Lebmach ein dementsprechendes Zeugnis auszustellen, da er mit Fleiß und mit vollstem Eifer mir die elektrische Installation sehr nett und fehlerfrei montierte.
Die Arbeit wurde vom 14- Februar bis 30. April 1920 verfertigt; dasselbe steht bis heute ein volles Jahr in Betrieb und wurde nicht im mindesten reparaturbedürftig. Ich spreche daher nochmals meinen besten Dank aus und empfehle ihn jederman aufs beste.
Unterfertigt von Karl Gratzer als Arbeitsgeber und als Bürgermeister
Stampiglien Gemeinde Sörg und Julius Gaggl, Mühlen- und Maschinenbau, Lebmach
Lebmach 28.6.1922 L e h r b r i e f womit bestätigt wird, daß Michael Wohlfahrt, geboren am 4. Sept. 1900 in Freundsam Gemeinde Sörg, Bezirkshauptmannschaft St.Veit Glan Religion katholisch, bei mir durch 3 Jahre und zwar vom 1.4.1917 bis 1.4.1920 das (Mühlen) und Maschinenbauhandwerk vorzüglich erlernt hat und sich während dieser Zeit alle Kenntnisse seinen Berufes erworben und sich treu, sittlich und fleißig betragen hat, weshalb er allen Gewerbsgenossen als Gehilfe bestens empfohlen wird.
Außerdem wird bestätigt, daß M.W. vom 1.4.1920 bei mir als Vorarbeiter zur vollsten Zufriedenheit gearbeitet hat und ist im Bau von landwirtschaftlichen Maschinen, Wasserkraftanlagen, Mühlen (Einschub: Reparaturen derselben) und bei elektrischen Installationen sehr tüchtig und daher jedem Gewerbsgenossen zu empfehlen.
Datum Unterschrift Stampiglie Julius Gaggl.
Lebmach 2.4.1923 Z e u g n i s womit bestätigt wird, daß Michael Wohlfahrt vom 1.4.1920 bis 1.4.1923 bei mir als Gehilfe tätig war. Derselbe ist in allen in das Fach einschlägigen Arbeiten praktisch und fleißig und kann daher jedem Geschäftskollegen empfohlen werden. –
Stampiglien, Unterschr. Julius Gaggl und Gemeinde Pulst, f.d.Bgm. (Hans) Gaggl Sekr.
Lebmach 1.6.1931 Z e u g n i s Gefertigter bestätigt daß M.W. bei mir von1.4.1917 bis 1.4.1920 die Tischlerei für Maschinenbau erlernt hat, kann auch Möbel und Bautischler Arbeiten und hat sich während dieser Zeit alle Kenntnisse seinen Berufes erworben und hat sich treu, sittlich und fleißig betragen, weshalb er allen Gewerbsgenossen als Gehilfe zu empfehlen ist.
Unterschrift Julius Gaggl, Stampiglien u. Unterschriften Gemeine Pulst bzw.
Genossenschaft der vereinigten Gewerbe für den GB St.Veit,
Vorsteher Franz Eckhard
Bodensdorf, 6.6.1931 B e s t ä t i g u n g daß Herr Wohlfahrt Michael, geb.am 4.9.1900 in Sörg bei untenstehender Lokalbauführung als Tischler in der Zeit vom 18.9.1930 –
13.12.1930 und vom 4.5.1931 bis auf weiteres beschäftigt ist und seine ihm zugewiesenen Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit seines Arbeitgebers ausführt.
Im Besonderen sei auch des ernsten Lebens in- und außerhalbl der Arbeit hingewiesen.
Stampiglie Ö.Lokalbauführung für Wildbachverbauung in Bodensdorf am See
Unterschrift, Der Lokalbauführer Ing. Ü b l a g g e r .
17 Vr 2141/34 Der gefertigte Untersuchungsrichter Landesgerichtsrat Dr. Schulz bestätigt hiermit, daß Michael Wohlfahrt, Tischler in Hörzendorf welcher während des letzten Putsches in Haft gesetzt wurde, heute über Weisung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen Gelöbnis entlassen wurde. (weil das Strafverfahren eingestellt wurde)
Landesgericht Klagenfurt, Abt 10 am 18.8.1934 – Stempel und Unterschrift
handschriftlich: 27.7.1934 !!
Weißenstein 1946 T e s t i m o n i a l This is to testify that WOHLFAHRT MICHAEL
born und the 4.9.1900 has been working in the roof repair party from 4.5.1946 to
15.9.1946 to the full satisfaction of the British Camp leading. He was found to be
diligent and carefull.
271 Works Section R E Reigh eh. Englischer Lagerkommandant:
203 Internment Camp
Weissenstein a.d.Drau
203 P.O.W. CAMP
Frieda Valent verh. Wohlfahrt (Gurk 21.9. 1902 – Lebmach 2.7.1985)
Februar 16, 2023 um 17:34 | Veröffentlicht in St.Veit | Hinterlasse einen KommentarStarkes Mutterherz in einem bewegten Jahrhundert
Friedas Eltern, Franz 1867-1951 und Helene Valent, geborene Bulfon 1870-1939 kamen aus Friaul , der Vater aus Pianis in der Pfarre Portis – heute besser bekannt als Carnia, die Mutter aus Ovedasso in der Pfarre Moggio Udinese (zu Deutsch Mosach). Ovedasso zählt heute zu den verlassenen Orten der Region. Die Angabe von Venzone als Geburtsort von Franz Valent in seinen meisten Urkunden ist eigentlich irreführend. Das entsprach einer Übung den nächst größeren, den bekannteren Ort heranzuziehen, um die Orientierung zu erleichtern. Venzone hieß übrigens zu Deutsch „Peuscheldorf“.
Wie kommt es aber, dass drei Kinder des eingangs erwähnten Elternpaares in Kärnten, noch dazu in Gurk das Licht der Welt erblickten? Der Reihe nach waren es Engelbert (1899), Aloisia (1901) und Frieda. Die Antwort darauf ist eine lange Geschichte. Man muss zeitlich sehr weit zurück blättern, am besten in jene Zeit, wo Kaiser Franz Josef, der…
Ursprünglichen Post anzeigen 6.921 weitere Wörter
Kraindorf im Kroatengau
Dezember 7, 2022 um 15:45 | Veröffentlicht in St.Veit | 1 KommentarFür die zwei Titelbegriffe gibt es Klärungsversuche in E. Kranzmayers Ortsnamenbuch von Kärnten. Zunächst wird im 1.Teil Seite 89 darauf hingewiesen, daß Ortsnamen die auf -dorf enden, in Kärnten eine Leitform slowenischer bzw. deutscher Großkolonisation jedenfalls v o r 1100 darstellen. Krain wird von Kranzmayer vom slawischen krinja d.i. „Einkerbung“ abgeleitet. Die erste urkundliche Nennung von 1230 lautet Chreindorf. 1459 liest man Kreyndorff, 1568 Khrendorf und 1677 Guett Khreindorff.
Es stellt sich zunächst die Frage, wo findet sich eine geländemäßige „Einkerbung“? Die von der heutigen Hofstelle am wenigsten entfernten Einschnitte wären das Beißendorfer Bächlein am Zigeunerbergl und der Lebmacher Bach im Westen! Oder war vielleicht die Einkerbung in Form einer Rodung gemeint, wenn etwa ursprünglich zwischen Lebmacher Wald und dem Zigeunerbergl noch geschlossener Bewuchs bestanden hätte? Nun weist wohl das ältest erhaltene Urbar von 1459 unter der Überschrift Kreyndorf insgesamt 8 Halbhuben auf, wobei die Lage einiger davon dem Beißendorfer Bächlein durchaus nahe gewesen sein können. Der Mühlteich von Beißendorf ist jedenfalls uralt und hat dessen Ausfluß auf seinem Lauf hinunter in die Ebene des Glantalbodens bestimmt sehr früh schon mehrere Mühlen aufgewiesen. Von einer Kraindorfer Mühle genau an diesem Rinnsal ist noch 1902 ausdrücklich die Rede, als man zur Sanierung eines altgegebenen, aber vertragslosen Zustandes mit dem Nachbar kurzerhand einen Kaufvertrag hinsichtlich Mühle und Zugang abschließt. Daß die Kraindorfer Mühleschon länger dort benützt wurde, vielleicht noch von mehreren Kraindorfern gemeinsam, beweist ein Blick in die Katastermappe von 1828, sie zeigt genau an gleicher Stelle eine kleine Gebäudemarke.Es darf daher ebensogut an das alte kärntnerische Wort Krenn, auch Krön, Wasserkrenn (Mühlkrenn), d.h. Wassergerinne, gedacht werden. Das würde dann sogar ein rein deutsches Krenndorf erlauben, noch dazu wo es für ein slowenisches krinja-ves keinen einzigen Beleg gibt.
Zur Klärung des Begriffes „Kroatengau“ lesen wir Interessantes ein weiteresmal bei Kranzmayer 1.Teil Seite 70 unter § 42. Sein Zugang über die Sprachforschung läßt Kranzmayer in den „Kroaten“ des Kroatengaues Slowenen besonderer Rechtsstellung erblicken. Es ist dabei die Rede von Hirten oder Oberhirten, also von einer Herrscherschicht, oder von Trägern der slawischen Wehrverfassung. Für Kärnten allein betrachtet, würde deren Seßhaftigkeit gerade im Herzstück des Landes und dazu in einzigartiger Gunstlage ebenso dafür sprechen, wie die Tatsache des reichlichen späteren deutschen Königsbesitzes an eben diesen Stellen. Nach Niederwerfung des letzten slawischen Aufstandes hätte dann eben eine neue Feudalherrschaft die alte abelöst.
Die Gegend um Kraindorf dürfte so wohl schon zusammen mit dem tausendjährigen Lebmach 979 an die Aribonen und von diesen 1020 an das Kloster Göß gediehen sein. Es handelte sich dabei um einen Güterkomplex der sich von Lebmach (Amt) bis nach Sörg und Pflausach, Puppitsch, Beißendorf, Treffelsdorf, auch gegen St.Leonhard und an manchen Orten noch darüber hinaus erstreckte. Über 7 1/2 Jahrhunderte konnte dieses geistliche Besitztum nicht nur zusammengehalten, sondern dort und da noch ausgebaut werden. Im Unterschied zu weltichen Grundherren hatte man ja weder Erben noch Bräute auszuzahlen, nicht persönlich an Kriegszügen teilzunehmen und selbst ein Aussterben der Besitzerfamilie kam nicht in Frage.
Das in der Österreichischen Nationalbibliothek Wien verwahrte Gößer Urbar von 1459 führt nicht nur die acht Kraindorfer Halbhuben, sondern auch deren Inhaber und Dienste, sprich Abgaben, genau an. Der Zins betrug einheitlich 80 Denare, ebenso das Vogtrecht zum Amte Kraig je 15 Denare, die Abgabe an das Gurnigamt 12 Denare. Einheitlich waren auch die Korn- und Haferdienste, nämlich jeweils 2 bzw. 4 Vierling, wie die Abgabe an das Marschallamt von 3 Maß Hafer je Hof. Nur die Hälfte der Huben mußte Kleinrechte reichen und zwar jeweils 3 Hennen und 10 Eier. An einen einzigen Bauer waren bereits zwei Halbhuben verliehen und dieser Zug zu größeren Wirtschaftseinheiten hielt an. 1507 gab es bereits zwei Hubbetriebe zu je 4 Halbhuben und seit dem Jahre 1650 gilt Kraindorf als Einzelhof.
Einer der zwei letzten Teilbesitzer war Peter Finster, gestorben 1612. Er hat sich als Zechprobst beim Bau des Lebmacher Kirchturmes besonders verdient gemacht. Hingegen galt noch 1569 ein Christian Kraindorfer zusammen mit einigen Lebmachern als Lutheraner. Sie sind zum Prädikanten nach St.Veit „ausgelaufen“.
Der neuen Besitzgröße entsprachen nun auch durchaus potentere Betriebsinhaber wie Christian Weinberger (1697), Hans Mulle (-1701) Ferdinand Mulle-„Lebmacher“ (1707), Johann und Ignaz Lebmacher (1776). Damit findet sich hier, nebenbei bemerkt, ein gutes Beispiel dafür, wie sich zu jener Zeit noch Familiennamen trotz direkter Abstammung auf einmal ändern konnten.
Inzwischen hatte die Grundherrschaft für Kraindorf insofern gewechselt, als mit Kaufvertrag vom 8.5.1767 – fünfzehn Jahre vor dessen Auflösung – das Kloster Göß, sein ganzes Amt Lebmach, Kraindorf eingeschlossen, um 17.000 Gulden an den Eisenherrn Freiherr von Egger abgab. Entweder sah man schon die kommenden Ereignisse voraus oder waren die Mühen und Widrigkeiten der Verwaltung eines so fernen Komplexes wirklich, wie behauptet, zu groß geworden? In der Folge gehörte Kraindorf zur Herrschaft St.Georgen am Längsee, welche im Zuge der Klosteraufhebungen ebenso von der Familie Egger gekauft wurde.
Die alte Ordnung galt noch etwa 100 Jahre, ehe mit der Aufhebung der Grundherrschaften ganz neue Verhältnisse eintraten. Nach Abhandenkommen der zinspflichtigen Untertanen wurden viele Güter, so auch Kraindorf, an Leute abgestoßen, die darin mehr eine Geldanlage oder Spekulationsobjekte erblickten. Die Eigenwirtschaft mit Verwalter und aufgenommenen Landarbeitern war eine weitere neue Möglichkeit. Dazu mußte allerdings entweder ein größerer Eigenbedarf an Landprodukten oder eine gesicherte Absatzmöglichkeit für dieselben gegeben sein. Für Kraindorf mit seiner Stadtnähe sprach dabei einiges.
Gemäß Kaufvertrag vom 1. Juli 1844 kam das Gut zusammen mit der Krendl- oder Gartnerhube in Radelsdorf und der Lercherhube zu Predl, Bezirk Kraig von Michael Rothauer, bürgerlicher Handelsmann in Klagenfurt in die Hand von Franz Xaver Rauscher, Klagenfurt 1806-1863, Gutsherr auf Freudenberg und Ehrenthal sowie Besitzer des Hauses Klagenfurt, Neuer Platz 13. Er war ein Sproß des alten, gleichnamigen Mosinzer Gewerkengeschlechtes. Nach dessen Ableben erbte zunächst das jüngste seiner sieben Kinder, der 1842 geborene und schon am 24.6.1866 als junger k.k.Leutnant bei Custozza gefallene Franz Xaver Rauscher. Nur wenige Monate vor seinem Tode hat er am 27.3.1866 einen Kaufvertrag mit seinen Schwestern Gabriele Rauscher und Maria von Buzzi geschlossen. Seine finanzielle Lage war zu dieser Zeit bereits aussichtslos. Die Lercherhube in Predl – heute im Besitze von Dr.Hubert Knaus – musste er schon früher abstoßen.
Die beiden Schwestern waren gezwungen, zusätzlich zu den übernommenen Verpflichtungen weitere Darlehen in Anspruch zu nehmen. Selbst der Abverkauf des Besitzes in Radelsdorf an Karl Kirchmayer in Zweikirchen brachte keine wesentliche Erleichterung. Allein bei der Kärntner Sparkasse betrugen die bücherlichen Lasten mehr als 3.000 Gulden. Dieses Geldinstitut führte dann auch Exekution und 1881 kam es zur Zwangsversteigerung des Gutes Kraindorf. Den Zuschlag erhielten Gustav und Maria Stock um 10.600 Gulden.
In rascher Folge wechseln nun die Eigentümer und zwar folgen gemäß Kaufvertrag vom Jänner 1890 Leopold Schmidt, mit 20. Oktober 1891 Georg und Maria Kantz, das waren seit 1888 die Besitzer der Leitgebhube und Erbauer des Schlosses in Lebmach. 1901 verkauft Baronin Maria Kantz als Witwe Kraindorf an Walter Freiherrn von Sterneck und 1905 das Gut Lebmach an Franz Wutte. Für einen Hof sind so rasch aufeinanderfolgende Besitzwechsel höchst unzuträglich. In der Regel geschieht wenig Positives für Haus, Stall und Feld. Es denken die meisten nur an schnellst möglichen Verkaufsgewinn ohne von einer vernünftigen Wirtschaftsführung all zu viel zu verstehen.
Mit dem Zuzug der Eheleute Emil und Antonia Zelzer lt. Kaufvertrag vom April 1906, kommen nach langer Zeit wieder Eigentümer auf das Gut Kraindorf um auch hier zu wohnen und selbst zu wirtschaften. Dieser Kauf war aber mit großen finanziellen Anstrengungen verbunden. Vom Kaufpreis in Höhe von insgesamt 50.000 Kronen, davon 15.000 Kronen für das bewegliche Inventar, konnten lediglich 15.000 Kronen bar aufgebracht werden. Für die restlichen 35.000 Kronen war auf dem Kaufobjekt pfandrechtliche Sicherstellung zu bieten und weil dafür die wertmäßige Deckung gar nicht ausreichte, kam es zusätzlich zum Afterpfandrecht per 15.000 Kronen auf einer in Wien zu Gunsten des Emil Zelzer vorhanden gewesenen Hypothek. Der vereinbarte Zahlungsplan sah vor, dass 15.000 Kronen bis 1.1.1907 und 20.000 Kronen bis 1.1.1910 bei 4 1/2 %-iger Verzinsung fließen sollten. Ausdrücklich untersagt war jedwede Holzschlägerung, ehe nicht die nächsten 15.000 Kronen bezahlt sein würden.
Vorerst gab es aber unerhört viel an den Gebäuden, im Stall und auf den Feldern nachzuholen. Emil Zelzer, 1865 in Wien geboren, war ausgebildeter Ökonom und hatte zuvor verschiedene große Gutsverwaltungen inne. Er war sich ganz sicher, dieser Herausforderung durchaus gewachsen zu sein. Tragischerweise verstarb er jedoch schon 1912 mit 47 Jahren. Seiner Witwe verblieb solcherart eine sehr schwere Bürde.
Für verschuldete Bauern waren Kriegszeiten insoferne günstig, da sie verhältnismäßig leicht rückzahlen konnten. Dies galt zunächst auch für Kraindorf. Aber schon in der folgenden Zwischenkriegszeit schlugen Strukturmängel und Absatzprobleme wieder voll durch. Wie für die meisten anderen Glantaler Bauernwirtschaften war auch hier das NS-Entschuldungs-verfahren Rettung in letzter Not. Es bestand darin, alle drängenden Verpflichtungen in ein billig verzinstes und langfristiges Darlehen des Reiches zusammenzufassen. Plötzlich hatte nämlich die landwirtschaftliche Produktion aus leicht verständlichen Gründen wieder erste Priorität. Es gab in Sonderfällen sogar Extramittel für sogenannte Aufbaupläne, womit die Landwirtschaf-ten weites gehend modernisiert werden sollten ehe es in die „Erzeugungsschlacht“ ging!
Auf Antonia Zelzer (1861-1940) folgte nach Überspringen einer Generation ihr Enkel Dr. Franz Erian (1913-1984) laut Einantwortungsurkunde vom 25.3.1942 im Besitze.
Dr. Erian übte jahrzehntelang, als einer der ersten im Glantal, den Beruf des Tierarztes aus. 1985 wurde der zwischenzeitig zum Demeterhof gemachte Besitz im Gesamtausmaß von rund 50 ha der Witwe Isolde Erian, geborene Stromberger eingeantwortet. Eine Besitzhälfte ist im Jahre 1989 auf den Sohn Ing. Wilhelm Erian übergegangen. Die gegenwärtige biologische Wirtschaftsform ist nicht nur modern und zeitgemäß, sie verspricht mit ihren sehr gefragten Erzeugnissen in Verbindung mit persönlichem Engagement auch jene Erträge, die für den Fortbestand eines so altehrwürdigen Hofes einfach gebraucht werden.
Frieda Valent verh. Wohlfahrt (Gurk 21.9. 1902 – Lebmach 2.7.1985)
Juni 7, 2022 um 12:44 | Veröffentlicht in St.Veit | 7 KommentareStarkes Mutterherz in einem bewegten Jahrhundert
Friedas Eltern, Franz 1867-1951 und Helene Valent, geborene Bulfon 1870-1939 kamen aus Friaul , der Vater aus Pianis in der Pfarre Portis – heute besser bekannt als Carnia, die Mutter aus Ovedasso in der Pfarre Moggio Udinese (zu Deutsch Mosach). Ovedasso zählt heute zu den verlassenen Orten der Region. Die Angabe von Venzone als Geburtsort von Franz Valent in seinen meisten Urkunden ist eigentlich irreführend. Das entsprach einer Übung den nächst größeren, den bekannteren Ort heranzuziehen, um die Orientierung zu erleichtern. Venzone hieß übrigens zu Deutsch „Peuscheldorf“.
Wie kommt es aber, dass drei Kinder des eingangs erwähnten Elternpaares in Kärnten, noch dazu in Gurk das Licht der Welt erblickten? Der Reihe nach waren es Engelbert (1899), Aloisia (1901) und Frieda. Die Antwort darauf ist eine lange Geschichte. Man muss zeitlich sehr weit zurück blättern, am besten in jene Zeit, wo Kaiser Franz Josef, der Habsburger, Friaul bis weit nach Udine regierte und er es sich erlauben konnte, freiwillige junge Männer von dort in seine große Armee zu berufen.
Der Großvater
hieß Giovanni Batista Valent, geboren 1831, seit 1867 mit Maria Colle vlg. Moiza verehelicht. Er war es, der im Alter von 20 für 12 Jahre des Kaisers Soldat wurde, mit der Eheschließung jedoch entsprechend lange warten musste. Wohl konnte er sich mit seinem langen Dienst das Recht erwerben, sich später, wo immer im Kaiserreich frei niederzulassen. Zu der Zeit lebten noch seine Eltern, die aus ganz bestimmten Gründen hier angeführt seien: Vater Francesco Valent de Lungie, Mutter Maddalena Cucche. Weil es in Portis so viele Valent gab, wurden Großfamilien mit Sopranamen versehen. Der Großvater gehörte dem Clan der Lungie, also dem der Großgewachsenen an. Man beachte die jeweiligen Taufnamen. Sie werfen ein besonderes Licht auf die wechselnden Vorlieben und Neigungen der taufenden Priester. War der Name Francesco noch eine eindeutige Verneigung vor dem österreichischen Imperator Franz Josef, so ist bei Giovanni Batista, zumindest was die Priesterschaft betrifft, eine Schlagseite hin zur Italienischen Wiedergeburt erkennbar. Da fehlt noch ein Wort zu den slawischen Bräuten. Vermutlich hat man solche ab und zu aus dem Resia-Tal geholt. Dieses Hochtal bildet einen Übergang von Resia im Canale ostwärts hin zur Socia (Isonzo). Wir werden auf den slowenischen Einschlag der Familiengeschichte der Valent später noch zu sprechen kommen.
Weil sich die politische Großwetterlage in Friaul zwischenzeitig gegen Österreich und zu Gunsten eines möglichen eigenen Königs zu ändern schien, blieb dem kaiserlichen Veteran Giovanni Batista kaum etwas anderes übrig als vom freien Niederlassungsrecht des Kaisers Gebrauch zu machen. Er siedelte sich kurz entschlossen bei Tiffen, nahe Feldkirchen an, kaufte Ross und Wagen, was er vom Militär her scheinbar gut kannte und bot sich damit den in Feldkirchen schon seit längerem sesshaften Lands- und Geschäftsleuten an. Dortige Maurer- , Steinmetzmeister und Private brauchten viel Material wie Steine, Ziegel und, Kalk etc. auf ihren Baustellen. Das Geschäft ging gut und 1890 konnte Giovanni mit einem Darlehen von 8.000 Kronen die Edenbauer Hube in Schwambach, Gemeinde Glanegg kaufen.
Großvaters Erstgeborener Franz
war der eingangs genannte Franz, welcher seiner österreichischen Schulpflicht zwischen November 1874 und September 1882 in der einklassigen Volksschule Tiffen schon in Kärnten nachkam. Franz Lobisser, sein Lehrer war kein Geringerer als der Vater des späteren Kärntner Künstlers Suitbert Lobisser (Jg 1878). Zu Schuleintritt war Franz sieben und zum Ende fünfzehn Jahre alt. Wenn wir jetzt seinem Lebenslauf folgen wird sich das Rätsel um die Kindstaufen in Gurk von selbst lösen.
Über seine Lehrzeit als Maurer existiert ein Zeugnis des Lehrherrn Domenico Missoni, ausgestellt in Moggio am 9. Sept. 1900 (!) Demnach hätte die Lehrzeit vom 1. April 1884 bis zum 1. November 1886 gedauert, ob in Moggio oder anderswo steht nicht eindeutig fest. Das späte Datum und das perfekte Deutsch des Zeugnisses lassen anderes vermuten, weil, Maurermeister auch in Feldkirchen gegeben hat. War vielleicht der Feldkirchner Maurermeist zur Lehrlingshaltung zu so früher Zeit noch nicht befugt und so hätte man die Lehrzeit einfach nach Moggio verlegt? 1887 bis 1889 und nochmals 1892 bis 1893 war Franz Maurergehilfe bei Baumeister Albin Bulfon in Feldkirchen, wo er die dort im Haushalt beschäftigte, mit Meister Bulfon verwandte Helene kennen lernte und 1892 zur Frau nahm. Für den Anfang kamen die Jungvermählten im Elternhaus des Bräutigams in Schwambach unter. Später mieteten sie sich in Oberhaidach ein. Als noch ungeprüfter Maurermeister und Partieführer wirkte er von Ende 1896 bis Ende 1897 bei der Glan-Regulierung und war dort vor allem für Brückenbauten und betonierte Gefällstufen zuständig. Im Folgejahr nahm ihn Baumeister Johann Felice als Polier auf. Johann Felice, Althofen – wohl auch ein Friulaner – hatte den Bauauftrag für die Gurktal Schmalspurbahn Treibach-Klein Glödnitz bekommen.
Mit Sack und Pack
ging es jetzt der neuen Arbeit nach, eine sehr schwere Zeit für Gattin und Mutter Helene. Es gab noch keine Möglichkeiten regelmäßig zur Arbeitsstelle bzw. von dort zurück zu kommen. Die neuen Wohnadressen wechselten laut Geburtsbucheintragungen bei jedem Kind: dreimal in Gurk, davor einmal Althofen, Unterer Markt 47. Dort ist 1898 Maria Valent zur Welt gekommen. Sehr interessant ihre Taufpatin, diese war die Wirtstochter Ottilie Huber, aus St. Veit, später mit Leo Knaus verehelicht und daneben von Dr. Arthur Lemisch inoffiziell zweimal geschwängert. Es wurde dies erst in jüngster Zeit durch Genproben bewiesen. Auch wenn Franz wann immer Taufpatinnen suchen musste, fand er solche nicht selten unter Kellnerinnen oder Wirtstöchtern!! Das zeigt, dass er guten Wein zu schätzen wusste. Bei ihrer Geburt 1902 hatte Frieda schon vier Geschwister in rascher Folge. Das erstgeborene Brüderlein Peter (1893) hat nur wenige Tage gelebt. Mathildes (ca.1895) Geburtseintrag zu finden, war mir bislang nicht möglich. Auch Sterbetag und Sterbeort irgendwo bei den Donau-Schwaben zu eruieren ist angesichts der dort stattgefundenen Unruhen zu Kriegsende 1918 nicht gelungen. Dass Mathilde dorthin gelangte ist darauf zurückzuführen, dass die Herrin auf Gut Kraindorf, Frau Zelzer, knapp vor Ende des Ersten Weltkrieges Verwandtenbesuch mit Kindern hatte, wobei Mathilde als Kindermädchen so gut entsprach, dass sie eingeladen wurde, bei den Kindern zu bleiben und nach Ungarn mit zu kommen. Die Eltern willigten ein, aber von Mathildes weiterem Schicksal hat man nie mehr was gehört!
Glücklicher hatte es Schwester Maria (1898-1986) insofern, als sie. ebenfalls als Internierte in der Oststeiermark weilend, sehr jung Mutter und Witwe wurde. Der Vater von Sohn Willi heiratete Maria noch ehe er in den Krieg zog und er kam nicht wieder. So wurde diese Schwester zur vermutlich jüngsten Kriegswitwe und blieb es bis zu ihrem Ende 1986.
Ehe wir uns jetzt größtenteils dem Lebenslauf von Frieda Valent zuwenden, noch ein kurzer aber wichtiger zeitlicher Vorgriff zur Vita ihres Vaters Franz Valent:
Vom 18. bis 25. 2. 1904 stellte er sich der Maurermeister-Prüfung in Klagenfurt, die er bestand. Die erste Maurermeisterkonzession mit Standort Schwambach wurde ihm 1905, die zweite mit Standort Lebmach im Mai 1919 verliehen.
Über Intervention von Franz Wutte, Gutsbesitzer in Lebmach und Bürgermeister der Gemeinde Pulst wurde der Meister samt Frau vorzeitig aus der Internierung entlassen. Man bezog eine einfache Wohnung in dem von Wutte erworbenen Mulle Haus in Lebmach wofür Herrn Wutte ein E-Werk inklusive Talsperre im Lebmacher Graben und Druckrohrleitung mit Wasserturm billigst herzustellen war. Durfte Franz Valent dafür tatsächlich Rechnung legen, dann hat bei Wuttes schleppender Zahlungsweise die Inflation das meiste aufgefressen.
Einen ähnlichen, gleich unprofitablen Großauftrag erteilte ihm Sohn Kajetan Wutte am 11. Juli 1949 nachdem dessen Wirtschaftsgebäude ein Raub der Flammen geworden war. Der diesbezügliche Arbeitskontrakt, besser gesagt Knebelungsvertrag wird im Anhang gebracht werden, weil er so richtig zeigt, wie schlecht kalkuliert wurde und warum der Herr Maurermeister es nie zu einem gemauerten Eigenheim gebracht hat. Er starb 1951 in einer armseligen Holzbaracke und hat leider dort gespart, wo er nie hätte sparen dürfen, nämlich an einer guten Bürokraft, an einer Kostenstellen-Rechnung, der Grundlage jeder Kalkulation. Bei normalen Aufträgen genügte noch der gute Hausverstand, aber bei Großaufträgen wurde regelmäßig dazu gezahlt, anstatt den gerechten Unternehmerlohn durchzusetzen!
F r i e d a
Wir folgen von nun einem jungen Leben, zugleich einem neuen Jahrhundert und fragen uns was die neue Zeit Schweres der Welt im Allgemeinen und Frieda im Besonderen bringen wird. Das Aufwachsen in einem Dorf voll von Kindern und Verwandten war schön und harmonisch, nicht so schön dann die Schulzeit. Der erste Schulweg führte von Schwambach nach St. Martin. Da wurde sie regelmäßig von den Kindern der einheimischen Bauern als Wallische beschimpft. Später wurde mit dem Wohnsitzwechsel nach Oberhaidach die Volksschule in Zweikirchen für sie zuständig. Was bislang Mitschüler an Gehässigkeit lieferten, das besorgte in Zweikirchen der Lehrer höchstpersönlich, bis Frieda mit 13 Jahren vorzeitig aus der Schule gerissen und mit Eltern und Geschwistern außer Landes gebracht wurde. Wie das? Mit dem Eintritt Italiens in den 1. Weltkrieg auf Seiten der Achsenmächte, stand der Feind plötzlich an der Kärntner Grenze. Das österreichische Militär fürchtete Spionage der sogenannten Reichsitaliener von Kärnten aus und ordnete deren Internierung in das Hinterland an. Die Gendarmen waren nicht gut informiert und gingen von Posten zu Posten sehr unterschiedlich vor. Der Gendarmerie-Posten von Glanegg, für Schwambach zuständig, war übertrieben streng. Alle Schwambacher Männer, die einmal aus Friaul eingewandert waren oder schon in Kärnten geboren sind, wurden ohne Unterschied an einem einzigen Tage abgeholt, zur Bahn gebracht, dort dem Militär übergeben und in Richtung Burgenland/Oststermark verfrachtet. Nur der Edenbauer, Christian Evaristo Valent, war aus unbekannten Gründen im nahen St. Lambrecht interniert und kehrte als einziger vorzeitig heim. Hätte nicht der Bürgermeister von Glanegg, A. Haberl, selbst ein Veteran des Kaisers, interveniert und sich für seinen Freund verbürgt, so wäre Giovanni B. Valent trotz seines einst dem Kaiser geleisteten Eides, trotz zwölfjähriger Dienstzeit und trotz des hohen Alters von 84 Jahren auch noch verschickt worden. Einen Tag nach den Männern folgten deren Frauen und Kinder.
Der Hauptbahnhof von St. Veit an der Glan
war kaum im schönsten Jugendstil vollendet und eröffnet (1912) da brach der Krieg aus und wurde danach bald zum Schauplatz der folgenden Geschichte, die mir von Christine Valent-Mitterer, Villach, im Juni 2000 anlässlich eines Begräbnisses in Schwambach erzählt wurde.
Teres Adele Valent, geborene Di Bernardo, Gattin des Christian Evaristo Valent war mit ihren 8 Kindern, und zu einem weiteren Kind schwanger, für den Abtransport in Viehwaggons eingewiesen, als sie am Bahnsteig weinend auf und ab ging, von dem Begleitoffizier gefragt was ihr Kummer sei. Mutter Courage wusste treffend zu antworten: „Sie verstehe die Welt nicht mehr, wie man so mit jemand verfahren kann, wo doch der Schwiegervater 12 Jahre treu und ohne Urlaub dem Kaiser von Österreich als Soldat gedient hat.“
Der Offizier hörte sich das geduldig und interessiert an, verfügte alsbald, dass der Zug vorerst nicht zur Abfahrt freigegeben sei, ehe er mit seiner vorgesetzten Stelle ein klärendes Wort gesprochen habe. Nach längerem Telefongespräch erreichte der mitfühlende Mann, dass die Mutter mit ihren Kindern in einen Zug Richtung Heimat gesetzt wurde. Noch am selben Tage kam die arme aber überglückliche Gruppe noch am Bahnhof Glanegg an, von wo bei strömenden Regen der gemeinsame Fußmarsch nach Schwambach erfolgte.
Nebenbei bemerkt: Auch unsere dreizehnjährige Frieda saß schon in einem der Viehwagen um mit Mutter und Geschwistern in die Oststeiermark gebracht zu werden. Sie landete für vier Jahre auf einem Bauernhof nahe Feldbach und hatte dort Haus- und Feldarbeiten zu leisten, aber auch Stall und Vieh zu versorgen.
Rückkehr nach Kärnten
Als zwölfjähriges Schulkind hat Frieda Oberhaidach bei Glanegg verlassen und als 17-jähriger Backfisch kehrt sie zurück, wohl nicht mehr nach Oberhaidach, sondern nach Lebmach ins Mulle Haus, wo die Eltern und Geschwister schon zuvor eine neue Wohnung bezogen haben.
Der schreckliche Krieg war vorbei, die Siegermächte zeichneten die Landkarte neu. Österreich-Ungarn und Deutschland waren die Verlierer. Ihre Nachbarstaaten langten mächtig zu. Italien hatte den Bund mit den Deutschen und Österreichern früh genug verlassen, sich neutral erklärt und sich dann mit den Feinden verbündet. Doch das ist nicht genug! Handfeste Versprechungen bezüglich Südtirol und Triest führten dazu, dass Italien Österreich sogar den Krieg erklärte! Kein Wunder, dass die Kärntner jener Tage keine gute Meinung von den Wallischen hatten.
Die politische Landschaft erfuhr empfindsame Veränderungen durch die Ablösung des Patriarchates einerseits durch eine ungeliebte Demokratie anderseits. Plötzlich durfte jeder kleine Mann seine eigene politische Meinung haben und kundtun. Väter und Autoritäten wurden kaum noch anerkannt: Gott Vater im Himmel, der Heilige Vater in Rom, der Landesvater in Wien wie letztlich auch Familienväter. Die politischen Leidenschaften durften frei ausgelebt werden. Bald stand jeder gegen jeden. So war das Land von außen und von innen gleichermaßen bedroht.
Es waren unsichere Zeiten für Frieda ganz persönlich und ihre Familie insgesamt. Ihr Erscheinen in Lebmach beunruhigte so manchen Junggesellen, darunter schon bald die zwei Rivalen Michel und Florian (Kersche)! Von Michel war bekannt, dass er der holden Weiblichkeit schon in jungen Jahren mehr zugeneigt war, als es seinem Leumund und Geldbeutel gut tat. Er wurde mit 17 erstmals Vater und bald danach zum zweiten Mal. Um mit Frieda bekannt zu werden, halfen ihm ihre Brüder Alois und Sepp, Michels Freunde. So erfuhr er auch, wann die Neue mit Familie auf den St. Veiter Wiesenmarkt zu gehen beabsichtigte. Wie zufällig fand sich dann auch Michel zu rechter Zeit auf der Landstraße ein. Seine Frage, ob der Herr Baumeister erlauben würde, dass er sich der Gesellschaft anschließe, wurde positiv beantwortet, weil man sich wohl schon von gemeinsamen Arbeiten gegenseitig kannte.
Jetzt war Michel recht zuversichtlich, dass ihm Charme, Erzähl- und Tanzkunst, vielleicht auch eine kleine Wiesenmarkt Aufmerksamkeit zum Ziel verhelfen würden.
Nach einem bekannten Kärntner Lied:
Ja Du liaba Michl kreuzparasol
Gelt die Junge Valent die g’fallat dar wohl
Manst wohl Du hast sie schon, brauchst sunst nix mehr
A b a wart, da wird da Kersch a Wort einlegn
Der laßt‘nit her!
Michl hatte am Wiesenmarkt wohl fleißig erzählt, aber kein Wort über seine zweimalige Vaterschaft verloren. Als Frieda später davon erfuhr, hatte Michl bei ihr keine Chance mehr. Frieda nahm die erst beste Gelegenheit wahr, bei Verwandten ihrer Mutter, den Bulfons von Feldkirchen eine Stellung anzutreten und Lebmach schnellstens zu verlassen.
Sollte Michl jetzt aufgeben? Nein, zu groß war inzwischen seine Zuneigung. Er setzte sich an Sonntagen immer öfter in den Zug nach Feldkirchen, wo er wusste dass Frieda frei hatte und, um es kurz zu machen: dort in Feldkirchen entstand Helene, die erste gemeinsame Tochter. Man ist sich also doch noch einig geworden, gemeinsam – wenn auch ohne Trauschein – durch das Leben zu gehen.
Immer noch ohne eigene Wohnung
kommen im Zwei-Jahres-Abstand drei weitere Kinder dazu. Die erste Niederkunft ereignet sich – wo sonst – bei Friedas Mutter und in deren neuem Zuhause, sehr beengt, beim Mulle in Lebmach. Rosa, Raimund und Franz kamen in Kraindorf zur Welt. In Summe ein gesunder und kräftiger Nachwuchs, doch alles unehelich, alles unter dem Namen Valent.
Jetzt drängte Frieda mit berechtigter Ungeduld auf eine Besserung der Wohnverhältnisse und Michel entsann sich seiner handwerklichen Fähigkeiten. Ein Abschnitt der Glan-Regulierung (Kraindorf-Feistritz) war gerade fertiggestellt worden und ließ eine Werkzeughütte direkt am Weg von Seidelhof nach Karlsberg ungebraucht zurück. Nach Einvernehmen mit dem Grundeigentümer und einem Darlehen von Michels Halbschwester, Tante Rosl wurde aus der Bauhütte ein zwar einfaches aber durchaus zweckmäßiges Wohnheim geschaffen, dazu noch Garten, Ziegenstall, Hühnerstall, Holztriste und Heuschober angelegt. Frieda fühlte sich wie im Paradies!
Für Isidor Valent, ein Onkel von Frieda war es 1931 selbstverständlich, dass Michel endlich auch kirchlich Ordnung machte. Die Trauung erfolgte in der Filialkirche von Lebmach. Die Hochzeitstafel richtete der Wirt Julius Gaggl derart aus, dass die Braut vom gepantschten Wein, eine schwere Alkoholvergiftung davon trug. Das sollte noch böse Folgen haben. Isidor Valent war Partieführer der Wildbachverbauung und leitete ein Baulos im Erl-Graben bei St. Veit. Dort war er behilflich, dass Michel eine Arbeit fand. Leider waren für Michel Parteitermine wichtiger als sein guter Posten. Seltene Fotos zeigen, wie Michel – voll in seinem Element – Bruchsteine für die Maurer zurichten darf, also durchaus gehobenen Dienst versieht. Er war bei jeder Arbeit bemüht, sein Bestes zu geben und Anerkennung zu finden. Nach seiner Teilnahme am Putsch von 1934 und Haft war eine Rückkehr zum Wildbach leider nicht mehr möglich. Wie groß Michels Verlangen nach Zugehörigkeit, Anhänglichkeit und Treue schon in Kindestagen war, zeigt so richtig, dass er nach Übersiedlung seiner Eltern von Schloss Gradenegg nach Hohensgein eigentlich in die Volksschule Pulst sollte. Er wollte aber Lehrer und Mitschüler in Gradenegg nicht missen und ging tagelang heimlich den sehr weiten Weg in die alte Schule (!).
Dazu passend ein späteres Zeitbild: Michels Kinder gingen Walderdbeeren suchen. Gleich über der Glan erstreckte sich damals ein großer Kahlschlag bergan. Da fand man mehr als Beeren! Rosalia war ca. 6 Jahre alt und entdeckte einen angebrannten Holzpflock umwickelt mit Kleiderstoff, der ihr sehr bekannt vorkam. Sie hatte selbst ein solches Kleidchen gehabt. Das Ganze war nicht gut genug mit Benzin getränkt und verbrannte deshalb auch nicht vollständig. Das Kind bringt diesen Fund mit heim und Frieda erschrickt zu Tode. War das doch ein Beweis dafür, dass Michel bei der von höchster Parteistelle angeordneten Aktion zum Abbrennen eines Hackenkreuzes am Nordhang des Karlsberges beteiligt war. Der zur oder von der Wiener Regierung im Sonderzug vorbeifahrende Italienische Außenminister Graf Ciano sollte wohl beeindruckt und von der Rührigkeit der Hitler Anhänger in Österreich überzeugt werden.
Die 30er Jahre
waren familiär und politisch eine hochbewegte Zeit: Hochzeitsfeier mit starker Alkoholvergiftung der Braut, weitere drei Kinder geboren, Übersiedlungen mehrmals! Teilnahme Michels am gescheiterten Putsch und anschließende Haft im Landesgericht Klagenfurt.. Über Monate ist Frieda mit der größer gewordenen Kinderschar allein unten an der Glan. Es kam zum Mord an Bundeskanzler Dolfuß. Der neuen Regierung in Berlin ist kein Mittel schäbig genug, um dem Nachbarland Österreich Schwierigkeiten zu bereiten: Neben der Tausend-Mark-Sperre – sie galt von Mai 1933 bis Juli 1936 – und bewirkte dass jeder Deutsche, der über die Grenze nach Österreich wollte, 1000 Reichsmark zu hinterlegen hatte, was den zaghaft aufblühenden Fremdenverkehr schwer traf. Aber es gab es auch Versuche, dem Außenhandel Österreichs zu schaden. Mussolini wurde von Hitler nahe gelegt, den Holzhandel mit Österreich einzustellen, was vorübergehend auch geschah.
Der Gendarmerie-Posten Feistritz (heute Liebenfels) war damals in Radelsdorf untergebracht. Dieser verzeichnete eine wachsende Zahl von Verhaftungen, Anzeigen und Strafmandaten. Die öffentlichen Ruhestörungen, Spreng-Attentate und Provokationen gegenüber Staatsmacht und Gendarmerie, auch gegen politisch Andersdenkende waren schon vor der Verbotszeit Gang und Gäbe. Die Gendarmen wussten wohl immer Bescheid welche Personen dahinter zu vermuten waren weil ja aus der Zeit davor alle Nazi, Sozi und Kommunisten namentlich bekannt waren.
Die Amnestie von 1936 brachte keine Beruhigung, im Gegenteil, die Nazis wurden noch aktiver. Es gab nächtliche Wurf-Aktionen von Propagandamaterial auf Straßen und Plätzen.
Quando eravamo povera Gente (Ginsburg)
Nach den Ereignissen von 1934 sah sich Michel schweren Vorwürfen seiner Halbschwester und Geldgeberin ausgesetzt. Sie sah die Rückzahlung nicht mehr gesichert, außer er würde seinen politischen Ambitionen total abschwören. Das wollte er aber nicht, denn er hatte im Knast mit seinem Mithäftling Kajetan Wutte neue Pläne geschmiedet! Wutte hatte ihm anvertraut, dass ihn sein Schwiegervater Planegger von St. Sebastian bald „heraushauen“ würde. Er wäre auch ganz sicher, das Holzgeschäft mit Italien würde wieder anspringen und daher entschlossen, sein Sägewerk wieder zu starten. Da würde er ohnedies einen Sagel sprich Sägemeister brauchen, Wohnung für diesen und seine Familie in der Mulle Mühle in Lebmach hätte er auch. Er solle nur kommen sobald er entlassen sei. Auch für Michels Wunsch, einen eigenen Baugrund zu erwerben, zeigte Wutte volles Verständnis und sagte zu, ein passender Grund für einen Hausbau würde sich leicht finden lassen.
Dies alles verleitete Michel zu folgenschweren Entschlüssen und diese kosteten die arme Frieda ihr Paradies an der Glan unten! Ein gewisser Simon Schumi aus Radelsdorf war nämlich bereit, die investierte Sach- und Eigenleistung bar abzulösen, womit Michel seine Schulden tilgen konnte. Das war ihm die Hauptsache. Was er damit seiner Frau und Familie antat zählte wenig. Als Mann war er schon immer gewohnt, einsame Entscheidungen zu treffen! Das Eheleben wurde davon nicht leichter, zumal auch Frieda durchaus zu eigenen Gedanken fähig war.
Nach der Alkoholvergiftung kamen vorläufig noch einmal zwei Kinder hinzu, beide ungewohnt schwach und kränklich, ein Bub rachitisch und blutarm, schulfähig erst mit sieben und ein Mädchen, das bis zu seinem frühen Tod mit neun Jahren auch nicht schulfähig war. Die Übersiedlung nach Lebmach hatte zur Folge, dass die Familie von nun an wieder in einem einzigen Zimmer zusammengepfercht leben musste, zwei Ziegen, die den Ortswechsel überstanden, sorgten für das Notwendigste. Geld war knapp, Arbeit zwar gefunden, aber der Lohn stockte von Anfang an, weil angeblich der Chef selbst auch keine flüssigen Mittel hatte. Tatsache ist: der große Besitz war total verschuldet und was im Gasthaus gesprochen wurde, stimmte auch: „Ein Wiener, namens Neumann gehe durch Wuttes Ställe und sage an, welche Ochsen zum Verkauf kommen sollen.“
In diese Zeit fiel die folgende Begebenheit: Es ging wieder einmal auf Weihnachten zu, da drängte Frieda „Michel geh doch hinunter ins Schloss, dass Dir endlich einmal der fällige Lohn ausgezahlt wird“ Michel ging tatsächlich, war aber bald wieder da mit dem Bescheid „Was soll ich Dir geben, hab doch selber nichts“ Frieda sagte „Da brauch ich gar nicht in die Stadt hinein, ohne Geld.“ Michel war aber nicht nur für das Sägewerk sondern auch für das E-Werk, den Elektro-Antrieb der Säge inklusive Lichtstrom für einige Lebmacher Häuser zuständig. Plötzlich ging im Dorf das Licht aus. Es dauert nicht lange, da erschien Herr Kajetan Wutte in der Tür und verlangte von Michel sofortige Abhilfe. Jetzt war Michel überraschend Manns genug und sagte „Wenn es schon für uns kein Weihnachten gibt, dann braucht ihr im Schloss auch kein Licht“ Wutte, der den Braten schon gerochen gehabt hatte, griff in seine Rocktasche und blätterte einige Geldscheine auf den Tisch, Michel wusste was zu tun sei und ging in die E-Zentrale. Es wurde tatsächlich wieder Licht und auch ein Weihnachtsfest.
In der Mulle-Mühle kam wieder ein Kind dazu und machte einen Wohnungswechsel in das Egger Haus notwendig. Dort gab es im Obergeschoß ein Zimmer, um einige Quadratmeter größer als bislang. Nicht leicht fiel Frieda der Abschied von lieben Wohnungsnachbarn in der Mühle, als da waren Frau Genofeva Rieser oben und die alte Liesa Meisterl ein Stock tiefer. Im Egger Haus wohnten dann im Erdgeschoß die „Schwarze Wutte“ verwitwete Schwägerin des Hausherrn und Wächterin der Spalier-Marillen, zum großen Garten hin. Aber auch die alte immer noch tätige Sefa (Klimbacher) mit Tochter Susanne und Enkel, das war der „Suse-Bua“ hausten dort. Im Obergeschoß hatte noch die auch nicht kleine Familie des Herrn Gemeindesekretärs Hans Gaggl, sowie die des Traktorführers Schien Platz und im Halbstock ein alleinstehender Eisenbahner und Bruder von Frau Olga Bölderl. Dort einzutreten hat Frieda ihren Kindern, vor allem den Buben streng verboten!
1938 mit Anschluss an das Deutsche Reich
Was schon lange in der Luft lag, Tage, Wochen und Monate hindurch da und dort für Unruhe sorgte, wurde Gewissheit, Österreich verlor seine Eigenstaatlichkeit. Die stets knappen Schillinge werden von der plötzlich nicht so knappen Deutschen Reichsmark abgelöst, denn es gab erstmals und ab sofort KINDERBEIHILFE. Was das für Frieda mit ihren vielen Kindern bedeutete, kann man sich unschwer vorstellen. Kajetans Versprechen im “Tschumpus“ bezüglich Baugrund war jetzt, da Kajetan vom Reich großzügig entschuldet und mit einem geldreichen „Aufbau-Plan“ ausgestattet war, nicht mehr wichtig. Er versteckte sich hinter seiner Frau, die hätte auch Geld in die Ehe gebracht, könne mitreden und sei ganz dagegen, auch nur die kleinste Parzelle herzugeben.
Jetzt hat sich aber nicht nur die Zeit geändert, sondern dank der neuen Machtverhältnisse auch Michels Mut und Zuversicht gestärkt. Er war nicht mehr der ewige Verlierer, nein er konnte auch einmal Gewinner sein. Er wollte endlich, dass Wort gehalten wird und fand auch die nötige Unterstützung: Eines schönen Tages fuhr der neue Herr NS-Kreisleiter als Nachfolger des alten Bezirkshauptmannes in Lebmach vor, um eine Sache für das NS-Mitglied Michael Wohlfahrt zu klären. Frau Wutte, allein im Schloss, empfing den Kreisleiter mit übertriebener Freundlichkeit und mit der Einladung zu einer Jause. Der Besucher lehnte höflich ab und erklärte er sei eigentlich nur kurz vorbei gekommen um zu hören, warum Frau Wutte gegen den Baugrunderwerb von Wohlfahrt sei. „Aber nein“ bemühte sich die Frau „ich habe ja immer zum Kajetan gesagt, gib ihm den Grund, dass er sich was eigenes schaffen kann.“ Das genügte dem Kreisleiter und ehe er sich verabschiedete bat er noch, ihm ehestens den Kauvertrag zur Kenntnis zu bringen. Kommt Frieda damit vielleicht doch noch ins verlorene Paradies? Ja und nein!
Michel läuft ein zweites Mal zu Hochform auf: Wieder wird er zum Häuslbauer. Baugrund (nicht der beste!) wird erworben, mit der Zufuhr von Baumaterial (meist ab Bahnhof Liebenfels) begonnen und durch Protektion gestattet, sich in eine Landarbeiter Wohnbau Aktion einzuschmuggeln. Diese Maßnahme zielte eigentlich darauf ab, Landarbeiterfamilien ein eigenes Heim zu bieten. Michel hatte wohl eine große Familie aber er war kein Landarbeiter. Bei größeren Höfen der Umgebung (Mente in Latschach oder Pliemitschhof bei Hochosterwitz entstanden – allerdings auf Namen der Hofbesitzer – augengleiche Wohnhäuser und stehen dort heute noch. Jetzt wird ausgehoben, betoniert und gemauert, gezimmert, größtenteils fertiggestellt und eingezogen. Die Finanzierung all dessen kommt von einem Darlehen der Rentenbank Berlin. Gewisse Baumaßnahmen bleiben absichtlich noch offen, weil Michel auch an eine eigene Werkstätte denkt. So bleibt Friedas Wunsch nach dem geplanten Badezimmer zu ihrem größten Leidwesen bis zu ihrem Ende unerfüllt! Dafür gibt es bald einen neu bestellten Garten, eine Wiese zum Mähen und den selbst gezimmerten Stall mit Heuschuppen darüber für Kleinvieh, wo 1945 auch eine Melkkuh Aufnahme finden soll!
Frieda dolorosa
Die Welt befindet sich bald wieder in einem Krieg, schlimmer und brutaler als je einer davor. Man hätte zwar erstmals Geld gehabt, doch man konnte dafür nichts kaufen ohne Bezugsschein und Lebensmittelkarten. Jetzt war alles rationiert und der tägliche Mangel kriegsbedingt. Trotzdem war die Begeisterung immer noch riesengroß. Die Deutschen fielen in Polen ein, eroberten Frankreich und waren bald tief auf russisches Territorium vorgedrungen. Der Endsieg, auf den alle im Lande hofften, blieb aus und wurde langsam immer unwahrscheinlicher. Aber nur nicht daran zweifeln, das könnte gefährlich werden und sogar das Leben kosten. Dabei war die Übermacht der Gegner immer deutlicher. Unser schöner Kärntner Himmel gehörte auf einmal den amerikanischen und englischen Bomben-Flugzeugen. Zu Beginn flogen Sie noch über uns hinweg um ihre vernichtende Last über den Städten des sogenannten Altreiches abzuwerfen. Unsere engere Heimat kam bald später dran: Klagenfurt, St. Veit – Glandorf, der Flugplatz Annabichl, die Bahnhöfe und Bahnstecken.
Michel war inzwischen am Flugplatz in Annabichl beschäftigt und Frieda täglich in großer Sorge um ihn. Man konnte nämlich vom Glantal aus beobachten, wenn Klagenfurt bombardiert wurde und meistens ging es dabei doch um den Flugplatz. Konnte sich denn Michel, später auch mit Sohn Franz, der dort Lehrling war, rechtzeitig schützen oder wurden sie zu Opfern? Gewissheit gab es immer erst am Abend nach Ankunft des letzten Personenzuges.
Helene, die Älteste, wurde als Nachrichten-Helferin eingezogen und nach Frankreich verpflichtet, zu ihrem Glück in einen ruhigen Winkel des Landes knapp an der Schweizer Grenze. Was wird sein, wenn die Invasion der Amerikaner und Engländer in der Normandie Erfolg haben sollte? Wird Helene dort frühzeitig wegkommen. Schwester Rosi war in Wien verpflichtet, die feindlichen Bombengeschwader zu orten und ihren Weg weiter zu melden. Wird sie heim können, oder wird sie den anrückenden Russen in die Hände fallen? Fragen über Fragen, die Frieda, mit einem Ohr am Radiosender, nicht los ließen. Das größte Problem war aber wohl Raimund, der Älteste. Er konnte der fanatischen Propaganda in den Wochenschauen nicht widerstehen. Er meldete sich, ohne jemanden davon zu sagen, voll Begeisterung freiwillig zur SS-Division Hitler-Jugend. Er wusste wohl, dass er noch keine 18 Jahre alt war und die Eltern Einspruch erheben könnten. Mit einem Bein weniger kam er nach tagelangem Beschuss durch die Schiffsartillerie in den Erstverbandsplatz von Reims/Frankreich hinter der Front. Von dort gelangte er nach Marienbad in Böhmen und jetzt erst erfuhren die Eltern davon vom traurigen Geschehen. Die Russen waren nicht mehr weit von Prag entfernt und so machte sich Michel mit der gefährdeten Eisenbahn auf den Weg, seinen schwerstverwundeten Sohn heim zu holen. Nach vielen bestandenen Hindernissen landeten die beiden um Mitternacht am Bahnhof St. Veit. Wie schafft man jetzt die letzten sieben Kilometer? Der nächste Zug ginge erst wieder am Morgen! Der Lokomotivführer eines Güterzuges hatte Erbarmen. Er ließ die zwei Geplagten zu sich in den Führerstand, versprach seinen Zug in Lebmach kurz anzuhalten und so geschah es auch. Das zweite glückliche Ereignis am Hauptbahnhof St. Veit für unsere Großfamilie, wiederum dank eines mitfühlenden Herzens, diesmal das eines Lokomotivführers. Die letzten 500 Meter bis zum Wohnhaus, nahm der Vater – selbst kein Hüne – den Sohn huckepack! Elend und Sohn im Haus!
Die letzten Kriegstage gingen hin, Kummer und Leid blieben! Wie wird es weiter gehen?
Raimunds Wunde war noch zu versorgen, was in einem behelfsmäßigen Lazarett am Wörthersee geschehen konnte.
Kriegsende – Totaler Zusammenbruch
Plötzlich gehörte Michel wieder zu den Verlierern. Es wird nicht lange dauern und man wird ihn wieder einsperren. Frieda wird dann neuerlich, diesmal unter besonders erschwerten Umständen, allein für die ganze Familie sorgen müssen. Es war die englische Besatzungsmacht, die wohl wusste, dass Feistritz (das heutige Liebenfels) knapp zuvor eine Nazi-Hochburg war; ein Grund auch dafür, sich genau in diesem Ort festzusetzen. Die britischen Soldaten, besser gesagt nur die Chargen, nahmen im Mai 1945 im Hause Rieder Quartier und blieben dort lt. Gendarmerie-Chronik bis Juni 1946. Unter dem Schloss Hohenstein entstand ein Zeltlager (große englische Militärzelte) für die britischen Soldaten und auf der anderen Seite des Schlosses ein großes provisorisches Lager für rd. 10.000 gefangene reichsdeutsche Landser (unter ihren eigenen Zeltplanen!).
Knapp bevor Michel von den Tommis abgeholt wurde, gelang ihm für seine Familie noch ein sehr wichtiger Erwerb und das kam so: Die Landstraße durch das Tal war schon tagelang mit flüchtenden oder vertriebenen Zivilisten aus dem Osten verstopft. Sie saßen auf von Pferden gezogenen Planwagen. Eine junge Milchkuh, am Wagen angebunden, sollte den täglichen Bedarf decken, war aber gerade in Lebmach am Ende ihrer Kräfte, musste losgebunden und zurück gelassen werden. Was Michel als Zahlung dafür geleistet hat, ist nicht überliefert. Das erschöpfte Tier erholte sich rasch und wurde zur Lebensrettung für eine ganze Familie.
Die Stationen der neuerlichen Haft für Michel lauteten: Ebenthal bei Klagenfurt, Wolfsberg und Weißenstein. Die größeren Kinder kamen alle heim, doch der Vater fehlte. Frieda musste entscheiden, was die älteren Töchter und Söhne machen durften und was sie lieber sein ließen. Die Engländer hatten sich an das sogenannte Fraternisierungsverbot (= keinen Verkehr mit Einheimischen) zu halten, taten es aber nicht. Im Gegenteil, so schnell wie möglich veranstalteten die Tommis Tanz-Abende im Rieder Saal, wofür natürlich Musikbegabte aus dem Lager der Deutschen und heimische Tänzerinnen gebraucht wurden. Kärntner Mannsbilder waren nicht zugelassen. Schlagworte von damals lauteten „Chocolate-Girls“ für die Damen und „Organisierer“ (sprich Diebe) für die Männer. Letztere waren begehrte Gegner im Fußball. Sie wurden verwöhnt mit allen Köstlichkeiten, mit sogenannten Fressalien (Weißbrot, Dosenfleisch usw.) und natürlich mit Rum und Whisky – aber nur so lange unsere Burschen die Verlierer waren! Es ging drunter und drüber und kein Vater da! Dementsprechend harte Vorwürfe an Frieda blieben später nicht aus.
Es ging um das nackte Überleben. Der Stall musste geben, was er hatte und ebenso der eigene Garten. Zu kaufen war wieder so viel wie nichts. Zum Glück gab es unter den Bauern noch gute Freunde des Vaters, denen er zu besseren Zeiten gute Dienste zu leisten wusste und die sich auch noch daran erinnerten. Dorthin wurden jetzt die Kinder um frisch gebackenes Brot geschickt. Je weiter der Weg desto freigiebiger die Bäuerinnen! So kamen die Kleinen oft bis Sörg, Gradenegg, Freundsam und noch weit darüber hinaus.
Dazu waren natürlich etwaige Hinweise des Vaters notwendig und höchst wertvoll. Für Frieda hingegen war es unbedingt notwendig, den Vater von Zeit zu Zeit zu informieren und zu fragen. Das war nicht immer und überall möglich, wohl aber in Weißenstein im Drau Tal. Es wurde irgendwie bekannt, von wann bis wann eine Arbeits-Partie im Steinbruch nahe dem Internierungslager ihre Arbeit aufnimmt. Wenn man sich bedeckt hielt, konnte man seinen Angehörigen treffen. Man musste nur warten, bis er einmal einen unaufschiebbaren Drang verspürte oder das zumindest vorgab. Die Bewachung außerhalb des Lagers machten nicht die Engländer selbst, sondern österreichische Gendarmen, was die Sache nicht unbedingt erleichterte. Ein großes Problem zu damaliger Zeit, war natürlich der öffentliche Verkehr. Den gab es so gut wie überhaupt nicht. Da hieß es dann, Autostoppen. Zum Glück übernahmen immer öfter deutsche Gefangene Lastfuhren für die Besatzer und die hatten meist ein Einsehen. Nur wenn dann die Rückreise solcherart in Klagenfurt endete, dann hieß es Friedas Schwester Maria aufsuchen, die in der Einigkeitsstraße eine eigene Wohnung hatte. Dort konnte man schlafen und warten bis nächsten Tag zeitig am Morgen ein Zug von Annabichl nach St. Veit mit Anschluss in das Glantal ging. Eine Weltreise jedes Mal, Langeweile gab es nicht. Die jüngsten Kinder, die daheim, blieben waren damals 15, 3 und 1 Jahre alt, alle nur in der Obhut eines Älteren!
Das Jahr 1955 und danach
Zehn Jahre lang musste Österreich auf seinen Staatsvertrag und auf seine Freiheit warten. Endlich war es so weit, die Siegermächte zogen ab, das Leben normalisierte sich. Michel fand zum zweiten Mal eine Beschäftigung bei der Wildbachverbauung. Ing. Üblacher, deren Chef in Villach, erinnerte sich des Namens und dass Michel einmal, wenn auch nur kurzfristig, ein vielseitig verwendbarer Mann im Bau-Los Vitus-Graben war. Jetzt hieß es allerdings wieder, der Arbeit zu folgen und nur alle Wochen oder vierzehntägig für ein Wochenende heim zu können, außer im Winter, da wurde ja „gestempelt“, d.h. Arbeitslosengeld bezogen. Frieda war wieder einmal für Schüler, Lehrlinge, für Stall und Haus das ganze Jahr alleine zuständig. Die Sorge für ihre Jüngsten ging fast nahtlos über in jene für ihre Enkelkinder. Während die älteste Tochter ledig und kinderlos blieb, hatte die nächste Tochter, namens Rosalia. drei Ledige. Sie war einst der Stolz des Vaters: tüchtig und begabt in jeder Hinsicht. Ihr adrettes Auftreten, ihr wohl geformter Körper und ihre Sinnlichkeit waren nicht gerade ihr Glück und für den Vater ein schweres Los. Jetzt musste sie aber ihrer Arbeit nachgehen, später mit ihrem Vater gemeinsam, ebenfalls bei der Wildbachverbauung, sie als Köchin. Während die Männer der Arbeits-Partie eine Baracke bewohnten kam die Köchin privat unter. Auch sie konnte nur zeitweise für Wochenenden heim. Das bedeutet für Frieda viel zusätzliche Arbeit von früh bis spät!
Die monatelange Trennung war auch für das Eheleben nicht besonders zuträglich. Michels Gasthaus-Hocken wurde zur lieben Gewohnheit, auch dann, den arbeitslosen Winter über zu Hause! Er war ja auch ein höchst begabter Erzähler und fand immer leicht begeisterte Zuhörer, im Gasthaus, wohlgemerkt! – nicht so sehr bei den Seinen. Da glaubte jeder, die alten Geschichten schon zu kennen. Welch ein Irrtum! Heute täten alle wieder gerne zuhören oder nachlesen, sogar seine Enkel und Urenkel, wenn er nur noch das wäre! Damals war Michel schon oft enttäuscht über das Desinteresse und desto länger blieb er dann, leicht angesäuselt auch hocken. Manchmal schickte Frieda gerne eines der Kinder ins Dorf mit den Worten: „Geh und hol den Vater heim“. Da konnte Michel dann ganz schön auf sein eheliches Leid zu sprechen kommen. Der Mühlenbauer, der er eben einmal war, verglich ein gelungen Eheleben mit einer guten Mühle. Letztere bestand aus zwei besonderen Mühlsteinen, dem Lieger unten und dem Läufer darüber. Gutes Mehl war nur zu haben, wenn der Lieger aus weichem, der Läufer aber aus hartem Stein war. Mit anderen Worten, die Ehefrau muss nachgiebig sein keine eigene Meinung haben! Das war nicht drin, denn Frieda hat das Leben und das eheliche Schicksal hart gemacht. Sie wollte und konnte nicht mehr zu allem Ja und Amen sagen, was Michel und seine Männlichkeit mitunter kränkte.
-Ein andermal ging Frieda sogar selbst den Weg ins Gasthaus – ein Spaßvogel konnte sie schon auch manchmal sein – und hatte eine kleine Säge bei sich. Sie trat beim Gaggl in die Gaststube und machte ernsthafte Anstalten, ein Stück von der Holzbank abzuschneiden. Das Gezeter der Wirtin beantwortete sie damit, sie wolle nur ein Stück von jenem Holz bei sich zu Hause haben, auf dem ihr Gatte es so gern und lange aushält.
Zu allem Überfluss fing Frieda jetzt auch noch zu kränkeln an: Hausarzt Dr. Lehofer und Kräuter-Ärztin Christine Widowitsch, Völkendorf 1) stellten gleiche Diagnosen: „Gallen-Kolik weil der Gallengang nicht durchlässig sei.“ Der Hausarzt wusste, dass es dafür in Österreich erst einen einzigen Operateur gibt und der sei in Amstetten. Doch Amstetten ist weit weg und Villach viel näher. So blieb Frieda von Zeit zu Zeit eben nur der Frühzug nach Villach und vom dortigen Bahnhof der Fußmarsch mitsamt dem Morgen-Harn nach Völkendorf. Der Rat von beiden lautete: „Keine Fette und Öle, nichts Paniertes, kein Geselchtes, nichts Gebackenes.“ Beim geringsten Versehen, meldete sich prompt eine höchst schmerzhafte Gallen-Kolik.
Die Jahre gingen dahin, die Kinder wurden größer, Sohn Franz zum Automechaniker, ja sogar zum Meister. Als hätte der alte Gaggl nicht schon den Vater und dessen Fleiß genug ausgenützt, jetzt musste ihm auch noch Sohn Franz unverdienten Vorteil bringen. Das war möglich, weil Gaggl genau wusste, die neue Straße werde über das Werkstätten-Gelände führen und die Ablöse für den Abriss der Gebäude wird für ihn höher sein, wenn er nachweisen kann, dadurch einen Pächter zu verlieren. Der Pächter hingegen ging vollkommen leer aus. Gut, er war nicht der beste Rechner und Geschäftsmann, ein guter Arbeiter allemal, aber ohne seine sparsame Erika wäre er wohl nie zum eigenen Haus und zu Baugründen in Hörzendorf gekommen. Erikas Vater war als Schneider in Weitensfeld nebenbei Versicherungsagent. Sein Geschäftstrick bestand darin, den Hauserrichten Kredite anzubieten , wenn sie bei ihm die Feuerversicherung abschließen. So hatte er im fortgeschritten Alter eine Menge Schuldscheine aber keinen Überblick mehr, wo er die Schuldner findet. Erika und Franz hatten Wochen zu tun, wenigstens einen Großteil davon aufzustöbern und abzukassieren. Bei Erika und Franz kamen bald die nächsten Enkelkinder an. Weil Frieda alle Kinder gern hatte und, nebenbei bemerkt, sogar den Erfinder der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner unterstützte – so gut sie nur konnte – machte sie jeder weitere Kinderzuwachs im Alter nur noch froher.
Schwere Schicksalsschläge blieben ihr dennoch nicht erspart. 1965 kam eine Schreckensnachricht aus Vorarlberg. Helene, ihr erstes Kind, wurde dort Opfer eines tragischen Verkehrsunfalles. Bei strömendem Regen mussten Fahrer und Beifahrerin das Auto verlassen, er um etwas zu reparieren, sie um den Regenschirm zu halten. Beide verdeckten vermutlich so die Rücklichter und ein nachkommendes Fahrzeug fuhr auf. Helene war auf der Stelle tot. Ihr Leichnam wurde heim geholt und am Lebmacher Friedhof beigesetzt.
Es dauerte nur noch wenige Jahre, bis nach unzähligen Krankenhausaufenthalten auch Michael ein unheilbares Leiden hinweg raffte. Das war 1972. Frieda lebte noch bis 1983 im Haus, liebevoll betreut von Tochter Rosalia und vorübergehend von Frau Sapper, Kurzzeit Geschäftsfrau in Pulst, und befreundet mit Giselher, Sohn von Raimund dem Ältesten. Was bislang die politische Einstellung des Mannes – z.T. durchaus von der Gattin geteilt – an Alleinsein verschuldete, erhöhte sich nun durch den elfjährigen Witwenstand.
Ü b e r d i e V a l e n t
Wie angekündigt, nun ein Überblick über Entstehung und Wanderschaft des Familiennamens. Dabei lässt „Alpe-Adria“ deutlich grüßen.
Zu einer frühen Zeit, waren Pfarrherren und Herrschaftsverwalter genötigt, ihren Schutzbefohlenen zur leichteren Unterscheidung statt Einzelnamen, auch noch einen Gen-Namen, also einen Familien-Namen zu geben. Was in den Städten schon üblich und früher notwendig war, dort meistens zu neuen Namen in Verbindung mit Berufen führte, war jetzt auch am flachen Land Usus. Hier gab es im kirchlichen Bereich die deutliche Vorliebe zu Taufnamen, d.h. zum Vaternamen, während bei weltlichen Grundherrschaften für Landleute eher Namens-Verbindungen üblich waren, die auf ihre Lage im Gelände hinweisen konnten: Berger, Taler, Bacher, Ober- oder Unter-Walder usw.
Die Namens-Geschichte der Valent begann im Missionsgebiet des Patriarchen von Aquileia. Dazu gehörten die Siedlungsplätze der Slowenen in Krain, im Küstenland, über Friaul bis Kärnten. Es ist erstaunlich, dass nicht der Papst sondern Kaiser Karl der Große, im Jahre 811 mit dem Drau-Fluss die Missions-Nordgrenze des Patriarchen festlegte. Da war wohl die Welt zwischen Kaisertum und Papsttum noch in Ordnung!
Nun zum Namenspatron, dem Heiligen Valentin von Terni. Dieser hieß bei den Slawen Valent, im Italienischen Valentino und bei den Deutschen Valentin. Der Gen-Name Valent muss entsprechend alt sein, sonst müsste er als Sohn des Valent nach späterer Übung im Slowenischen Valentic, wie in Italien Valentinovic oder in Kärnten Valentincic heißen.
Grabsteine in Slowenien oder Weinbauern im Collio zeigen heute noch den unveränderten Familiennamen Valent. Vom Collio wanderte der Name Richtung Udine und weiter bis Gemona und Venzone, warum wohl? aus einem gesegneten Landstrich mit guten Äckern und Weingärten in ein armes, regelmäßig von Erdbeben geschütteltes Land an Taliamento und Fella? Wohl aus Gründen der Überbevölkerung, wo die Jüngsten bei Zeiten eine neue Existenz finden mussten.
Die Namens-Wanderung von Friaul Friuli nach Kärnten hat nachweislich auch andere Ursache. In einem konkreten Fall ist belegbar, dass die vorübergehende Herrschaft der Habsburger in Venezien und in Friaul/Friuli es mit sich brachte, dass dort Soldaten für die Monarchie geworben und gefunden wurden. In der Regel verpflichteten sich junge, starke Männer für einen Dienst von zwölf Jahren in der österreichischen Armee. Dafür winkte ihnen freie Niederlassung wo immer im Reich. Jetzt kommt hinzu, dass die politische Stimmung in Friaul allmählich und ganz entschieden eine österreichfeindliche geworden ist. Österreichische Veteranen passten schlecht zum Rinascimento und zu Italia-Unitá. Wollte so ein Veteran nicht plötzlich zum Fremden in der eigenen Heimat werden, dann entschloss er sich, wie unser Giovanni Battista Valent und andere, wohl oder übel vom Niederlassungsrecht Gebrauch zu machen. So gab es eines Tages gar nicht wenige Friulaner, die sich in Kärnten niedergelassen haben und ihre Vater-Namen wie Candussi, Borghi, Vidussi oder Bulfon (einst ein Wilhelm!) mitbrachten.
1) siehe die Kärntner Landsmannschaft 0304/2021 Seite 4
Bildteil


vlg Edenbauer in Schwambach

stehend hinten von links: Tante Loisl mit Klein Martha, Michel, Frieda mit Klein Franz, Engelbert, Mitzi, Bruder N., Hugo, Willi Sittlinger, dessen Mutter Maria mit Klein Egon, Onkel Pepe, Onkel Alois
stehend Mitte von links: Helene stehend mit Großmutter Nonna, Großvater Nonno mit Maria
sitzend von links: Otto, Raimund Franz, Rosi
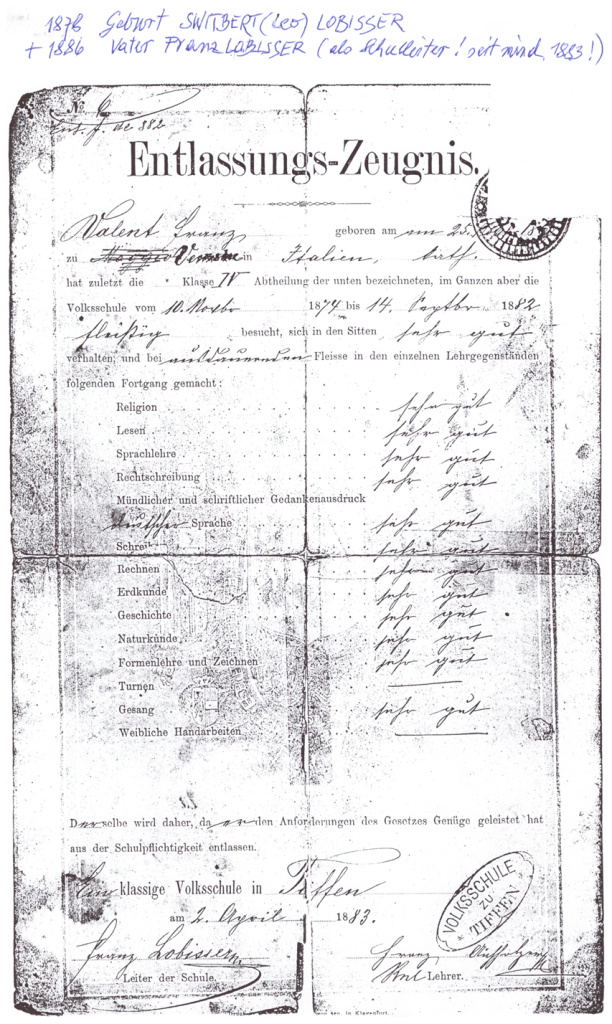
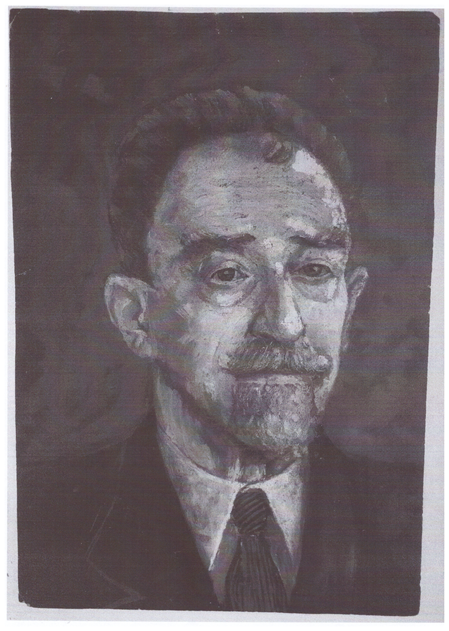
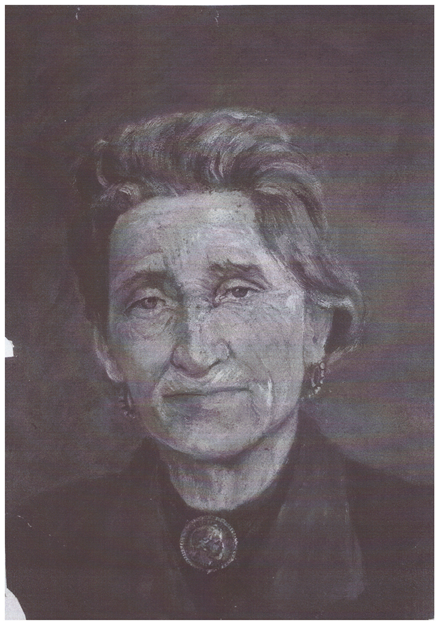
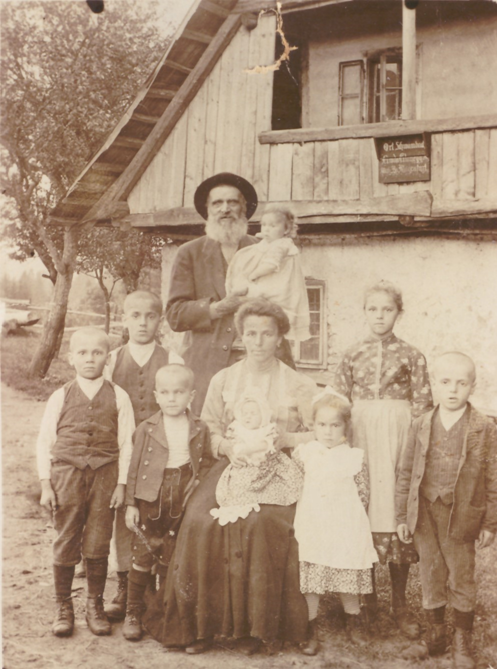


Hinten stehend erster von rechts Michael Wohlfahrt mit Respektabstand zu den Gendarmen vom Posten Feistritz/Radelsdorf!
Mitte stehend von links: Freund Candussi, Franz Valent, Rest unbekannt
Sitzend vorne rechts Gastwirt Julius Gaggl mit Gattin/Familie

Kaufleute 1887
November 3, 2021 um 17:14 | Veröffentlicht in St.Veit | 4 KommentareSchlagwörter: Anton Sornig, Bilderkrämer, Fritz Knaus, Ignaz Grimschitz, Jose Wratitsch, Karl Karner, Kommis, Krainer, Liebenwein, Roman Debriacher, Tierarzt Jellaschek, Zigeunerpferde

Es gab damals nur 13 Kaufleute in St. Veit, und zwar:
– Fritz Knaus
– Anton Sornig
– Ignaz Grimschitz (Grimschitz und Meierhofer)
– Josef Wratitsch (- 1889)
– Anton Korpitsch
– Liebenwein
– Roman Debriacher (+ ca. 20.1.1908 in Graz)
– Engelbert Schreiber
– Seybald
– A. Pagitz
– Johann Hirschenfelder (ca. 1846 – 26.4.1914)
– Johann Obleschak (20.5.1830 – 17.9.1905)
Außer diesen angeführten Kaufleute waren noch einige sogenannte “ Schmerstecher“.

Hervorragend war das Spezerei-Geschäft des Fritz Knaus, es hatte eine mit kaufmännischen Emblemen bemalte Fassade, hatte große Spiegelscheiben, Rollladen und Glasschilder, während alle anderen Kaufleute nur gewöhnliche Fenster mit Holzbalken und ebensolche Türen hatten.
Vor den Eingangstüren waren bei allen Geschäften ein Salzstock, ein Zuckerstock und ein Reisbesen als Auslage hingestellt. An Samstagen (Wochenmarkt) hängte man auch Leinenwaren und dgl. vor das Geschäft heraus und gar an Jahrmarkttagen, da wurde so viel als man unterbringen konnte, zur Schau gestellt.
Alle herumlaufanden Hunde in der Stadt versäumten nicht, besonders den Salzstöcken ihren Besuch abzustatten, einen Hinterfuß zu heben und einen Gssssst zu spenden.
Die Geschäfte wurden um 6 Uhr früh aufgesperrt und blieben bis 8 Uhr abends offen. Eine Mittagspause für die Angestellten gab es nicht und sogar an Sonntagen waren die Geschäfte bis 5 Uhr abends offen (in der Zeit meiner Schuljahre waren sie sogar bis 7 Uhr abends offen).
Der Lohn für einen Kommis betrug bei voller Verpflegung monatlich fl. Wenn man in einem Geschäft und besonders im großen Knausgeschäft manchmal lagen warten musste, hatte man Gelegenheit zu sehen, wie die 4 – 5 Kommis und die Lehrjungen unter der steten Aufsicht der noch jungen hübschen Frau die Kunden, nach Kasten sortiert, bedienten.
Man hörte „Küss die Hand gnädige Frau, mein Kompliment Herr Steuereinnehmer, meine Hochachtung Herr von Plochel, bitte gleich, bitte sehr, was steht zu Diensten Herr Doktor“ etc.
Fast jeder Kommis trachtete, die nobelaussehenden Kunden zuerst zu bedienen und die gewöhnlich aussehenden den Lehrjungen zu überlassen.
Zu Frauen der handarbeitenden Klasse sagten sie „Grüss Gott Frau Dumberger, was möchten‘s sie gern?“ Zur Frau Schusterbauer: „Was kriagns denn sö?“ Zur Frau Jauchenauert „Was woll‘s denn?“
Soeben übergab ein Kommis einer jungen Frau, der Gattin eines k. k. Beamten ein Viertelkilo Kaffee, welche beim Empfang der Ware im hohen Ton fragte, ob sie nicht Ceylon haben könnte. Der Kommis entschuldigte sich und tauschte ihr den Kaffee untertänigst aus, wobei er mit einem artigen Geschwätze ihre Zufriedenheit erhalten wollte, aber die hohe Dame achtete gar nicht darauf und ging hochnäsig weg.
Von den 2 danebenstehenden Frau meinte die eine, dass diese eine vornehme Dame sein müsste, weil sie der Kommis so respektvoll behandelt habe. „Dö kenn i schon über 6 Jahr“ sagte die Angeredete, „sie ist Kellnerin in Althofen gwösn und obendrein a schlechts Luadar. Heint glap sie, man kennt sie neamar und tuat, als won sie von wass Gott fürn Haus her wär“.
Die Frau Chefin, die öfters in längere Gespräche mit noblen Frauen oder Herren in Anspruch genommen wurde, übersah es manchmal, wie die niederausshenden Kunden, wenn selbe auch oft 4 mal so große Einkäufe machten, warten mussten. Jene bevorzugten diskursiven Standesfrauen oder Fräuleins der damaligen liberalen Zeit, welche das Kapitel Arbeit nur aus der Vogelperspektive kannten, hätten gewiss mehr Zeit zum Warten gehabt. Und wenn in einem solchen Falle so einer Frau die Geduld ausging, braucht es nicht wunder nehmen, wenn sie resolut wurde und sagte: “ Ja sie, wenn mein Geld weniger wert ist, kann ich ja ein andermal beim Grimschitz und Meierhofer oder beim Debriacher einkaufen.“ Das wirkte. Erst jetzt wurde in dieser Art der Bedienung Wandel geschaffen, weil man die Konkurrenz fürchtete.
Die anderen Geschäfte hatten nur 1 – 2 Kommis und 1 oder 2 Lehrjungen und es kam derlei weniger vor. Aber der Konkurrenzneid war auch unter allen Kaufleuten fast derselbe, wie unter den Handwerkern. Jede Köchin, jedes Dienstmädel, die für einen größeren Haushalt einkaufen gingen, wurden mit einen Stranuz Ziggarlan bespickt. Der Konkurrent gab ihnen schon mehr, Er gab ihnen wohl eine Jause oder gar ein Restl Zeug für eine Schürze, damit er sie für sein Geschäft gewinnen konnte. Besonders wichtig war es für die Kaufleute auf die Neujahrsgeschenke nicht zu vergessen, Ich hörte sogar sagen, dass ein Kaufmann Gulasch und Bier aus dem Gasthaus holen ließ, um der Kunde das Warten in seinem Geschäft angenehm zu machen, um gleichzeitig zu verhüten, dass derselbe mit der Konkurrenz in Verbindung komme.
Es mussten von den Kaufleuten auch die Gasthäuser häufig und fortlaufend besucht werden, oft auch Zeche für andere Personen bezahlt werden, um die Kundschaften zu erhalten.
Die Kaufleute mussten auch beinahe auf jeden Kirchtag erscheinen und einen oder zwei Bekannte aus der Stadt mitnehmen, damit, wenn sie selbst nicht so viel genießen wollten, durch Zahlung größerer Zeche das Lächeln des Wirtes erkaufen konnten.
Nach den hl. Antoniustage d.i. Mitte Jänner, wurde der sogenannte „Kalte Markt“ abgehalten.
Es kamen die Krainer mit ihren, weit über die Knie hinaufreichenden, faltigen, naturfarbenen Lederstiefel, mit ihren schmalkrämpigen Hüten, die zu ihrer Landestracht passten und breiteten am oberen Platze auf dem gefrorenen Erdboden Leintücher aus, legten die ausgeweideten Schweine, dann große Speckpachen, auch Filz, Leber und Schweinsköpfe, Schinken und Würste zum Verkaufe aus. Sie füllten mit ihren Waren nahezu den ganzen oberen Platz aus, Einige Krainer, welche kein Wort Deutsch kannten, mussten sich einen Dolmetscher aufnehmen – ich sah z.B. unter diesen auch den Schneider Osel.
1 Schweinskopf (4-5 Kilo schwer) kostete1 – 1 fl 40
1 Kilo Leber 15 – 20
1 ganzes Schrein per Kilo 40 – 44
1 Kilo Schweinfett 46 – 50
1 Kilo Filz 52 – 60
1 Stück Bratwurst (15 Deka schwer) 10 – 12
Zur gleichen Zeit kostete in St. Veit 1 Kilo Rindfleisch 40 – 42 fl.
War das Wetter kalt, stieg bei den Krämern der Preis um 2 -3 fl, trat Tauwetter ein fiel der Preis m2 -3 fl.
Ich kaufte einmal zwei Schreine um den Preis von 38 fl per Kilo. Ein Maria Saaler sagte mir, er habe solche sogar um 36 fl per Kilo gekauft.
In den letzten Jahren vor dem ersten Weltkrieg kauften ein paar kapitalkräftige Kaufleute den ganzen Speckvorrat den Krainern ab, um auf diese Weise, den ganzen Handel an sich zu reißen.
Nach dem ersten Weltkrieg kamen keine Krainer mehr zu uns herüber. Es blieb bis zum heutigen Tage nur mehr der Krämermarkt übrig.
Über den großen, weit über Kärnten heinaus berühmten Wiesenmarkt will ich nur berichten, was mir der damalige Bezirkswachtmeister der Gendarmerie, Herr Wolf erzählte. Dieser sagte „der ganze Pferdemarkt sei um die Mitte der Siebzigerjahre beinahe ganz in Zigeunerhände geraten.
Da legte sich der damalige Tierarzt Jellaschek ins Mittel. Er konstatierte fast bei allen Zigeunerpferden die Rotzkrankheit und auf diese Weise war es ihm möglich, die Zigeuner zu vertreiben. Weiters habe einer seiner Gendarmen jeden Zigeuner, den er aus der Stadt eskortierte, mit einer Scherre den Schnurbart auf einer Seite weggeschnitten. Ein solcher Zigeuner kam nie wieder nach St. Veit. An allen Markttagen hausierten uns unsere Ortsbettler ohnedies, Dazu gesellten sich aber auch viele fremde Bettler, welche sich an allen Ecken und Straßenkreuzungen postierten, ihre Gebrechen und Wunden bloßlegten und so das Mitleid der Vorübergehenden erweckten.
Stirzlermänner, – Weiber und Stirzlerkinder mit den herumgereichten Schnapsflaschen in ihrem besoffenen Zustande boten abscheuliche Szenen. Sie hielten sich meist in der Nähe des Villacher Tores und des Krapfenbäckseppel unter der Linde auf.
In den Buden und auch in der Stadt hörte man viele betrunkene Leute in den Wirtshäusern singen (besser gesagt schreien) und jodeln ohne Ende, oder auf den Straßen herumgaukeln zum Gaudeum der Schulkinder, bis, sie den Polizisten Fenz als Beute zufielen.
Im engen Gassl zwischen Jonke, Kupferschmied und Fleischhauer Alois Zechner, im Vorhause der Bezirkshauptmannschaft und im Vorhause des Bürgerspitales waren Bilderkrämer postiert. Unter ihren diversen Bilderbögen, welche sie das Stick zu 5 fl verkauften, fehlte nie das Bild mit den seufzenden Kreuzträger. Dann gab es Kaiser- und Papstbilder und viele Heiligenbilder. Moritaten.
So ein Halbherr mit einen abgeschossenen Schossrock und einer qauadrolierter Hose spazierte vor einem schrecklichen Bild, das mit Ölfarben auf einer 2 m ² großen Leinwand in 10 – 12 Tafeln eingeteilt gemalt war, mit einem sehr langen Stab hin und her. Er sang mit seiner unschönen Stimme in langgezogenen Tönen die Geschichte einer schauderhaften Begebenheit, die sich in Lodomerien oder in Ungarn zugetragen hat, herunter. Soeben zeigt er mit seinem Stab auf die 8 te Tafel, wo der Räuber sein Opfer mit einem langen Messer ersticht, das das Blut in einem großen Bogen herausspritzt, Die Frau des Moritatensängers, eine ältliche Runggungl mit extrahoher Frisur und eitlen Manieren in abgetragenen Herrschaftskleidern angetan, begleitet ihren Mann mit der Harmonika und sang wohl auch teilweise dazu.
War die Schaudergeschichte abgesungen, dann verkaufte er die Beschreibungen derselben per Stück um 6 fl an die umstehenden Zuhörer.
Öfters im Jahr kamen Slavonier in ihrer Nationaltracht mit Pferd und Wagen, auf den Wagen ein großes „Fase mit Essig“. Der Slavonier schrie halb singend „Assika“. Die Leute kamen mit großen Geschirren aus den Häusern und kauften den Essig, welcher per Liter vielleicht um 4 fl billiger war, als sie ihn bei den hiesigen Kaufleuten kauften.
In den 90 per Jahren kamen Händler mit Gummiballons. Sis hatten 40 – 50 Stück aufgeblasen auf Schnüren und trugen sie als Neuheit zum Gaudeum der Jugend herum, Es wurde viel gekauft und hier und dort oben in der Luft sah man die „Losgekommenen“ zerplatzen.
Zu Marktzeiten sah man auch einen Mann mit einem abgetragenen schwarzen Salonrock bei einem Käfig mit mehreren weißen Mäuslein stehen, welcher die folgsamen Tierlein für das schöne Fräulein oder den schönen Herrn, Planetten herausziehen liess.
Beim Oberlercher (heute Villacher Straße 6) beim Leitner und beim Feistritzer (heute Adolf Hitler Platz 20) gab es an den Markttagen Tanzmusiken, ausgeführt von versch. Landmusikanten.
So weit nach einem Fund von Ing. Hannes Trixner betreffend einen alten Text von Karl Karner.
Nun noch einige bildlichen Impression zum Thema Kaufleute in St. Veit:
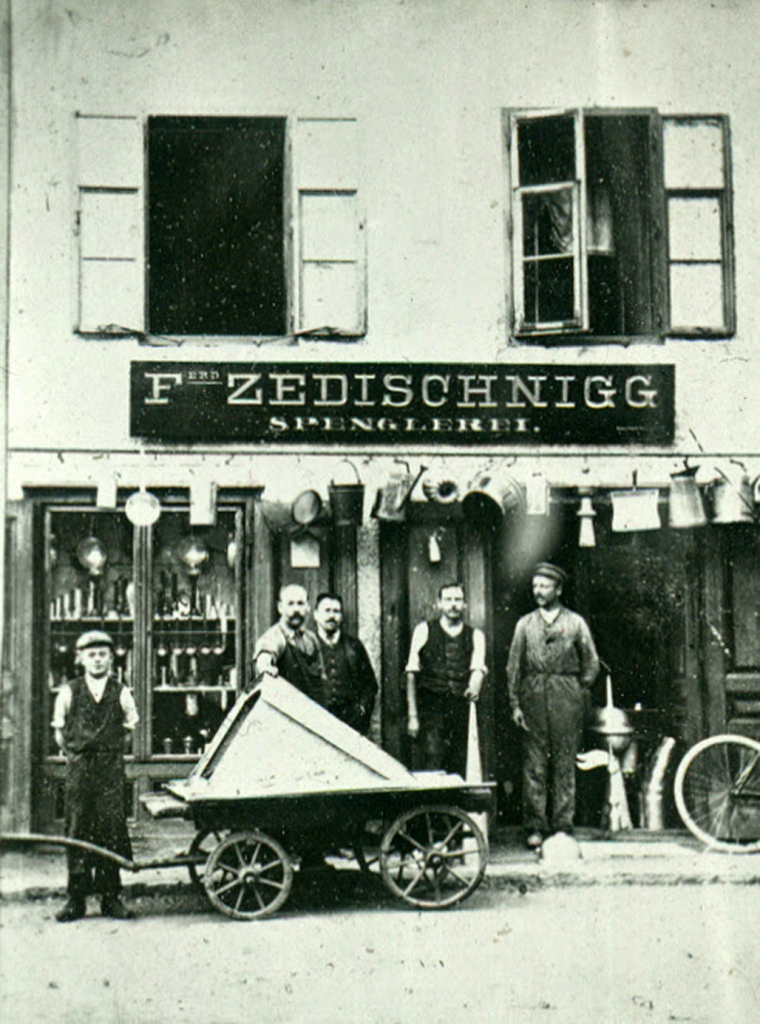

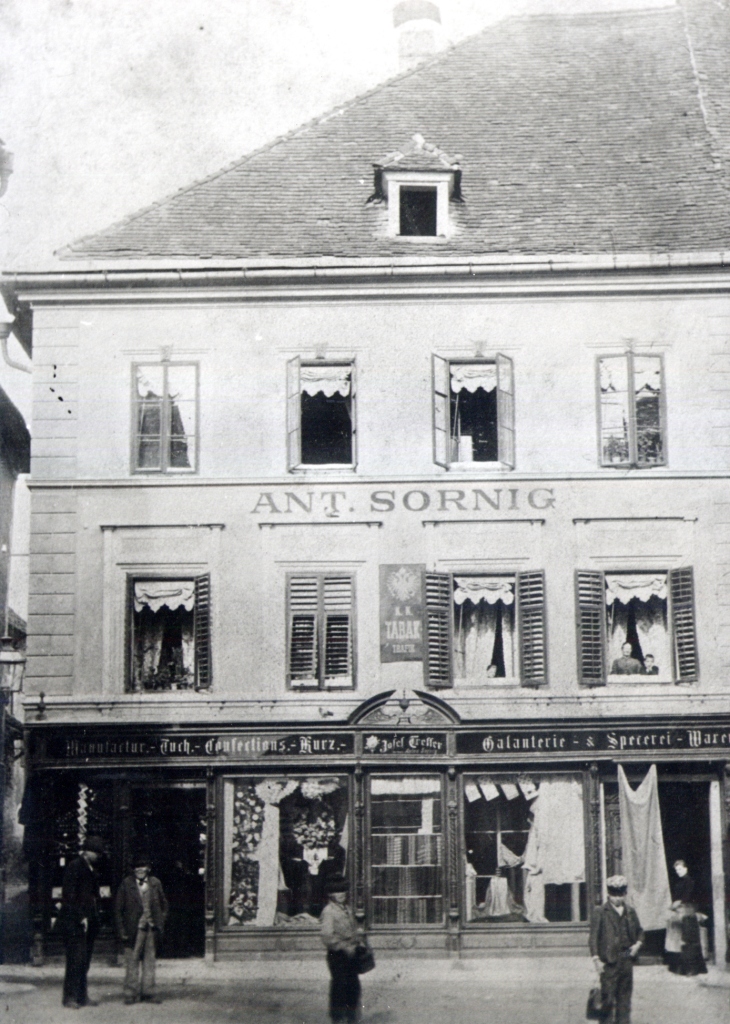
Beim Gaggl in Lebmach um 1924 bzw. um 1950
Oktober 13, 2021 um 18:36 | Veröffentlicht in St.Veit | 3 KommentareSchlagwörter: Auto Steyr 50, Candussi, Carnia, Cividale, Gaggl, Inflation, Kajetan Wutte, Kandussi, Lebmacher Bauern, Portis, Remanzacco, S. Lobisser, Sommeregger

Eine interessante Aufnahme, v.l.n.r.: Candussi Albin ? + 1962 oder Josef Kandussi 1895-1968 Betonwerk ? mit Freund Franz Valent 1867- 1951 Maurermeister in Lebmach anschließend Kommandant mit drei Gendarmen vom Posten Feistritz-Pulst/Radelsdorf, Franz Wutte mit Gattin, daneben Eheleute und Wirte Julius Gaggl mit Familie dahinter. Stehend dahinter 3mal unbekannt, rechts außen mit Hut und Gamsbart der „Gaggl Michl“.
Von wo die Candussi/Kandussi zuzogen und wann genau, war in den Pfarr-Matriken nicht zu finden. Fa. Rudolf Kandussi nennt die Stadt Remanzacco, (nordöstlich von Udine, an der Bahnstrecke nach Cividale gelegen)
Franz Valent wurde in der Pfarre Portis (heute Carnia) geboren, kam aber schon im Kindesalter nach Tiffen in Kärnten, wo er auch die Volksschule bei keinem Geringeren als dem Vater von S. Lobisser mit einem Vorzugszeugnis abgeschlossen hat.
Die Nachkommen des Josef Kandussi setzten die gewerbliche Tätigkeit fort und betätigten sich sogar in der Gemeindepolitik von St. Veit
Ansicht von Bachseite zeigt die typische Sonntagsstimmung.

Kajetan Wutte als Chauffer für unbekanntes Hochzeitspaar und mit seinem Pkw Steyr 50 – Ansicht von Straße, rechts nicht mehr im Bild befand sich die Kegelbahn, im Hintergrund ein Saalettl über dem Bach. Der Radfahrer auf der Brücke über den Lebmacher Bach strebt in Richtung Feistritz-Pulst (heute Liebenfels)
Zum neuen Hut des Gaggl Michl wäre noch zu bemerken, dass er knapp davor von seinem Chef den Monatslohn ausbezahlt bekommen hat. Er hoffte, sich damit einen neuen Anzug kaufen zu können, doch die Inflation war bereits eine „galoppierende“ und der Monatslohn reichte gerade für diesen Hut!!
Noch ein Wort zu den Freunden Candussi und Valent. Sie unterstützten sich geschäftlich gegenseitig, denn wo gemauert wurde waren auch Ziegel notwendig. Oder erfuhr der andere von einer bestimmten Bau Absicht, dann informierte dieser den Baumeister…..
Ein Wort noch zur Kegelbahn, welche ebenfalls an Sonn- und Feiertagen gut frequentiert war, nur für den armen Kegelbuben war es doppelt schwer, weil neben seinem Arbeitsplatz das Bumbs-Clo stand und immer einen erbärmlichen Geruch verbreitete. Dessen Ruf „Außakafn“ wurde selten gehört.
Nach der Familie Gaggl wurde das Gasthaus verpachtet. Nach Frau Sommeregger, einer flotten Wirtin und Pächterin, kam die Familie Buchleitner zum Besitz. Es entstand daneben ein schönes Wohnhaus, während der Gasthof geschlossen und das Gebäude gänzlich abgerissen wurde.
Arbeiten vor Errichtung des Arcineum St.Veit/Glan, Burggasse
August 22, 2021 um 12:21 | Veröffentlicht in St.Veit | Hinterlasse einen KommentarSchlagwörter: Arcineum St.Veit/G. Aushub der Baugrube, Festigung der Stadtmauer


Um die Stadtmauer zu sichern, musste diese mit Beton unterfangen werden. Dazu war es notwendig, das sandige Material auszuschwemmen und in der Grube zwischenzulagern.

Dazu wäre noch zu ergänzen, dass die nördliche Stadtmauer um die Baustelle mit Lkw und Baugeräten erreichen zu können rund 3Meter gänzlich abgetragen wurde. Als ungebetener Beobachter habe ich diese Maßnahme hinterher bemerkt und festgestellt, dass sich im Abbruchmaterial, soweit es noch an Ort und Stelle aufgeschüttet war, auch Artifakte, d.h. bearbeite Steine aus älteren Abbruchhäusern befunden haben. Der Großteil des Abbruch-Materials war schon mit unbekanntem Ziel abtransportiert. Eines davone hat der Nachbar, Herr Jerneischek in seine „Ausstellung“ übernommen.
Dies beweist dann allerdings, dass Karl Ginhart Recht hatte, wenn er andeutete, der Untere Platz, sei ursprünglich eine Vorstadt gewesen und erst im Zuge einer Stadterweiterung mit Einschuss des Burgturmes ummauert worden.
Herr Charly Jerneischek hat mich freundlicherweise auf den mir bislang unbekannten Bildbericht der Krone vom 11.7.2018 aufmerksam gemacht. Demnach wurden beim Aushub der Baugrube fürs Archineum Holzgebäude, Mauern und Öfen aus dem frühen 13. Jhdts. festgesellt (ohne nähere Untersuchung über Zweck allfälliger Gebäude). Vom Grabungsleiter Herrn Tiefengruber, Graz wurde dem BM Mock und den Brauträgern Pichler und Müller ein handgefertigter Tontopf, ebenfalls 13. Jhdt übergeben, der zu späterer Zeit im Neubau Platz finden sollte. Nach Wissen des Herrn Jerneischek ist das noch nicht geschehen.
Zumindest die Datierungen lassen annehmen, dass der in der Literatur genannte, herzogliche Hof, zu dem die Holden von St. Georgen verpflichtet waren zu Zeiten der Aussaat und der Ernte Dienste zu leisten, an dieser Stelle gewesen sein könnte und der ansonsten viel unterwegs gewesene Herzog Bernhard, seine Reitpferde hier versorgt wissen konnte. Die Stadt hatte damals noch nicht das heutige Ausmaß. Der Wachturm („Herzogburg“) für die Stadt bewachende Mannschaft – als Nachfolger des viel kleineren Wachturmes („Münzturm“) für den alten und kleineren Markt im Westen – stand solo, jetzt umgeben von ausreichend Wiesen und Ackerflächen aber noch ohne Stadtmauer.
Am Lugenbrückl 1887
Juli 14, 2021 um 21:26 | Veröffentlicht in St.Veit | 2 KommentareSchlagwörter: Sornig. Apotheke
Nach einem handschriftlichen Aufsatz von Karl Karner 1863-1945 – von W. Wohlfahrt konskribiert:
Wenn in den großen Geschäften Knaus oder auch beim Sornig, bei welchem auch k.k. Tabaktrafik war, eine stille Geschäftsbewegung eintrat, kamen die Frau des Fritz Knaus und die Frau des Anton Sornig auf das Eck vor Trabesinger und Knaus Speckmagazin heraus, um sich ein wenig auszuplaudern und frische Luft einzuatmen, denn sie mussten wirklich den ganzen Tag im Geschäft verbringen. Beide waren junge hübsche Frauen, wovon Frau Sornig kinderlos und lebhaften Temperamentes war. Sie erblickte soeben Frau Knaus und begrüße sie mit „Guten Morgen Frau von Knaus“ worauf sichtlich erfreut Frau Knaus erwiderte „Grüß Sie Gott, Frau von Sornig.“ Nachdem keine von beiden adelig war, belogen sie sich gegenseitig. „Denkens Ihnen Frau von Knaus, ich wollte heute mit´n Toni (ihrem Mann) nach Goggerwenig fahren, draußen bekommt man so gute Jausen und einen wunderbaren Rahmkaffee. Jetzt kommt eine Post vom Bezirksrichter Polei und von Dr. Moro dass sie in unserem Gartenhäusl zu einer Tarok-Partie zusammen kommen wollen.
„Sehens Frau von Knaus, so geht´s mir immer, wenn ich mich auf was freue“. „Aber mir geht es ja auch nicht besser. Frau von Sornig. Gestern Abend kam der Professor von Klagenfurt und brachte den Landesgerichtsrat aus Graz mit, welche beide mit meinem Mann befreundet sind und es ihnen versprochen hat, mit ihnen auf die Jagd nach Lölling zu fahren. Sie wissen ja Frau von Sornig wie es ist, es muss der Kogelwagen geputzt und gewaschen werden, nicht wahr? und dann hat man ja auch, wenn solcher Besuch da ist für mancherlei in Küche und Keller zu sorgen, Sie verstehen das ja, Frau von Sornig. Diesen Diskurs hört die Frau Trabesinger (Kaffeesiederin) in der Türe stehend und benützte eine passende Pause, während welcher Frau Sornig mit Herrn Heinzmann sprach, um Frau Knaus zu begrüßen uns sagte sich verbeugend „Mein Kompliment Frau von Knaus“ zu begrüßen, worauf sie von Frau Knaus mit „Guten Tag Frau Trabesinger“ abgefertigt wurde, weil Frau Trabesinger, obwohl sie Hausbesitzerin war, im Ansehen doch um eine Klasse tiefer stand als Frau Knaus.
Am Brunnen vor dem Premitzer Haus (heute 13. Märzplatz Nr 10 standen vier Weiber mit Wasserschäffern und übersahen im eifrigen Ratschen immerwährend wie sich andere das Wasser anleierten und wegtrugen. Sie schauten und gafften wie der Kogelwagen des verstorbenen Grafen Egger inhaltlich zweier Komptessen vorüber fuhr und wussten unglaubliches von ihnen zu tuscheln, was natürlich nur unter ihnen bleiben sollte und wahrscheinlich erlogen war und auch nicht unter ihnen blieb.
Vor dem Gasthof Grawein plätscherte der niedere Brunnen von dort weg auch die Knechte und die Mägde ständig Wasser trugen. Von dort herauf kamen Lehrer Polak und Florian Dust, machten bei der Reichel Apotheke dem Gaßmeier, der in der Türe stand einen stehenden Besuch. Gaßmeier hieß sie zum Fenster hinauf schauen wo Frau Frank Zeitung las. Schauts amal diese windische Wabn an, sie kann ja gar nicht lesen, sie tut nur so, sie hat ja auch die umgekehrte Zeitung in der Hand. Jetzt geht der Redl, der Klavierlehrer der Reichlischen Buben aus der Apotheke dem Oberen Platz zu. Gaßmeier und die zwei Lehrer schauen ihm nach und Gaßmeier kommt vor dass er dem Redl etwas nachzusagen hat, was vielleicht auch nicht wahr ist. In der nächsten Nähe hauste Schmerstecher Apolin, welcher auch gerne log und noch ein Stückl weiter (heute Klagenfurter Straße 10 hatte Wahrheit, der Millionär und Fleischhauer seine Fleischbank die auf der Straßenseite mit Brettern verschlagen war. Dort drinnen wurde auch viel gelogen und so mag wohl die Ortsbezeichnung Lugenbrückl entstanden sein.
geschrieben am 24. 9. 1942 in St. Donat
Ein ewiges Kommen und Vergehen und das in Notenschrift: Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alles gleich
Am Unteren Platz2
Juli 6, 2021 um 19:12 | Veröffentlicht in St.Veit | 1 KommentarHandschrift aus etwa 1939 – ausgegraben von Ing. Trixner, übersetzt von Walter Wohlfahrt:
Herr Mathias Grawein war ein hochgeschätzter, biederer Gasthofbesitzer wie auch Lebzelter und Wachszieher am Unteren Platz. Er schenkte gute Weine aus und führte eine vorzügliche Küche.
Sein Extrazimmer nannte man allgemein das „Wachsfiguren Kabinett weile es nur von Honoratioren mit Ausnahme zweier oder dreier kleinerer Intelligenzlern, welche dabei geduldet wurden geräuschlos besetzt war. Vom Rauchquall der feinen Zigarren drohte mehrmals das Licht zu versagen.
Heraußen aber, im großen Trinkzimmer, wo die Mittelständler und Handwerker und kleinen Geschäftsleute vertreten waren saß regelmäßig der Herr Dr. Prettner beim Ecktisch am Fenster mit dem Rücken gegen das Lugenbrückl. Um ihn herum saßen sein Lieblingsbürger und Besitzer der alte Mackler Regenfeldner, der Sattler Apolin, der Mlinek, der Getreidehändler Susitz und der bucklige Kronwirt Loise. Diesen Tisch nannten die Leute den Sekzierer-Tisch weil dort beständig von Lizitationen, wirtschaftlichen Zuwidrigkeiten und Prozessen gesprochen wurde. Die anderen Gäste, welche sich freimütig und lustig unterhielten und sich am Gesprächsinhalt des Sekzierer-Tisch nicht interessierten sangen mitunter Kärntener Lieder. Der Rauch heraußen von dem ordinären Pfeifentabak legte sich manchmal bis zum Boden nieder und man musste öfter die Türen ins Vorhaus offen stehen lassen, damit die Lichter wieder besser brennen konnten.
Besonders lustig ging es am Namenstag des Grawein zu. Es kam der ganze MGV dem Hausherrn wie auch seinem Sohn Eduard, welche beide sehr gute Baßsänger waren, zu gratulieren. Alle Tische waren mit Selchfleisch, Schinken, Würste, Reindling, Käse und Wein bedeckt. Zum Schlusse kam wieder wie alle Jahre auch der Tee-Wein und dies alles gab der Vater Grawein gratis! Schalkhaftes und Humoriges sprudelten immerzu. Es wurden auch Reden geschwungen. Selbstverständlich gab es auch Gesang und Musik (ein Sechstel der Stadtkapelle). Einmal wurden Vierzeiler nach Bauernart gesungen, wobei die Musik die dazu gehörigen Zwischen-Ländler zu spielen hatte. Wenn so viele Sänger daran einzeln beteiligt waren, wollte doch auch der beliebte Kaffee-Sieder Herwalik nicht zu kurz kommen und sang also „Sias is nit sauer und sauer ist nit sias – an Batschwiasta mog i nit, hot eiskalte Fiaß.
Wenn es besonders lustig herging konnten die hochstehenden Herren nicht umhin und kamen einzeln haus zum Volke um an den Lustbarkeiten auch teilzunehmen.
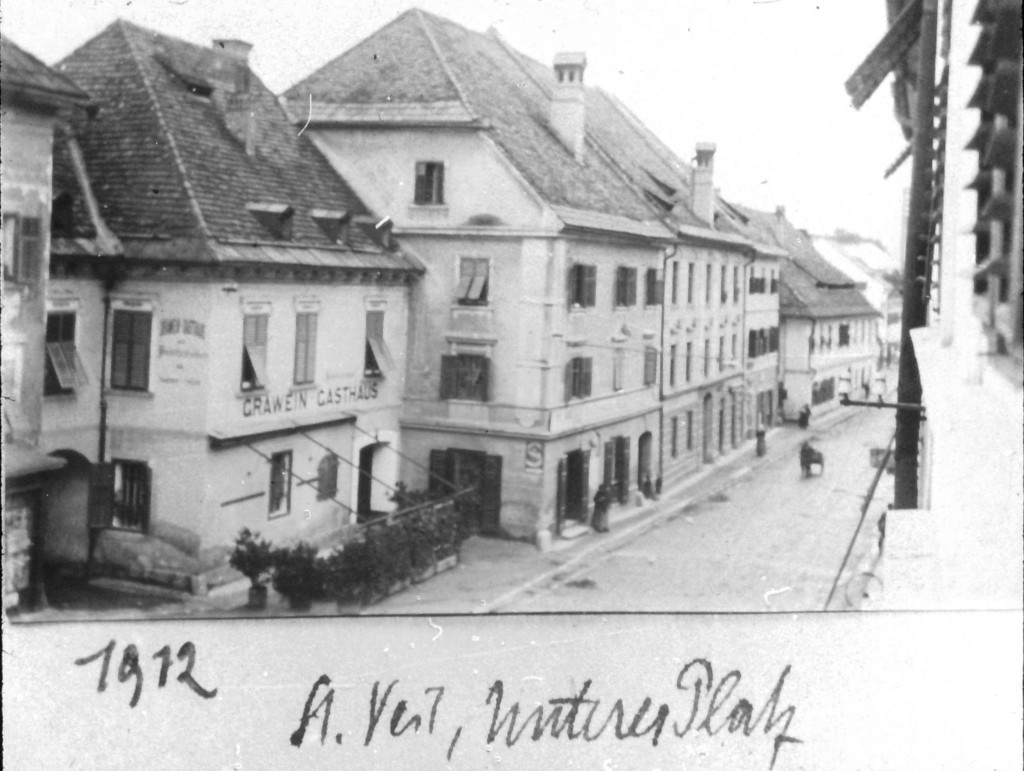
Dank Herrn Ing. Trixner hier die richtige Hausansicht vom Grawein am Unteren Platz. Bei der Gelegenheit: die Grawein kamen aus Villach und ursprünglich aus Südtirol. Vielleicht hieß er sogar einmal Grabein und galt für den Totengräber, wie auch andere Namen von der jeweiligen Tätigkeit herrührten, etwa der Klaubauf oder der Tragweg. An den Totengräber wollte man eines Tages nicht mehr erinnert werden und der jeweilige Matriken-Führer (Taufpriester) verschönerte den Namen.
Bloggen auf WordPress.com.
Entries und Kommentare feeds.
